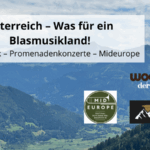Jubiläumsinterview 10/10 zu 10 Jahren KSL und Blasmusikblog
Die Fragen stellt: Helmut Schmid
In den 10 Jahren, die der Blasmusikblog und meine Firma Kulturservice Link schon bestehen, habe ich vielen Persönlichkeiten Fragen gestellt. Sowohl für den Blasmusikblog in unzähligen Round-Up-Posts und Interviews als auch in meinen Workshops und Zukunftswerkstätten. Zu meinem Jubiläum drehe ich den Spieß um und lasse mir Fragen stellen.
Die Fragen in diesem zehnten Interview stellt Helmut Schmid. Helmut ist Bundeskapellmeister des Österreichischen Blasmusikverbands ÖBV und Kapellmeister der Stadtmusikkapelle Landeck (Tirol).
Helmut: Publikationen im pädagogischen und künstlerischen Bereich wurden jahrzehntelang und werden immer noch über Printmedien veröffentlicht. Du hast hier einen neuen Weg gewählt – wurden deine Erwartungen (auch hinsichtlich Reichweite etc.) erfüllt und wie wird dein „Bildungsangebot“ angenommen?
Alexandra: “Den Blasmusikblog gibt es nun seit 10 Jahren; 850 Beiträge habe ich seither veröffentlicht. Momentan nutzen zwischen 6000 und 8000 Personen monatlich den Blasmusikblog. Je nachdem, was für Beiträge ich veröffentliche, können es auch mal mehr als 10.000 Nutzer pro Monat sein.
Ein Blog kann man eigentlich nicht mit einer Fachzeitschrift vergleichen. Ich stelle zwar sehr viele Informationen, Best-Practice-Beispiele, Repertoirevorschläge, viel Wissenswertes, Ideen, Input und vieles mehr online und berichte über Anlässe, aber alles hat immer einen persönlichen Touch, vieles ist gefärbt durch meine eigene Meinung. Das möchte ich so. Aber das unterscheidet den Blog komplett von einer Fachzeitschrift, die ja eher neutral berichtet.
Nachteil des Blogs: Die Akzeptanz wäre längst nicht so vorhanden, ich hätte längst nicht so viele Leser:innen, wenn die Inhalte etwas kosten würden – beispielsweise durch ein Abo-Modell oder eine Bezahlschranke. Während es bei einer gedruckten Fachzeitschrift kein Problem ist, Abo-Gebühren zu verlangen… Ein Kuriosum beim Blog: Meine Reichweite ist sehr viel größer als beispielsweise die gedruckte Fassung der Fachzeitschrift Brawoo. Und doch buchen die Firmen keine Bannerwerbung… (Anzeigen in Printmedien werden nach wie vor gebucht). Der Blasmusikblog wird also weder durch seine Leserinnen und Leser noch durch Firmen mittels Anzeigenwerbung finanziert – wie es bei Fachzeitschriften der Fall ist. Ein kleiner Deckungsbeitrag kommt durch das Affiliate-Programm in Kooperation mit dem Hebu-Musikverlag zustande. Wenn über einen Link, der einem Werk-Titel hinterlegt ist, eine Bestellung zustande kommt, erhalte ich eine kleine Provision. Manchmal erhalte ich einen Auftrag für einen sogenannten Sponsored Post von einer Firma (Verlag, Instrumentenhersteller, oder ähnliches). Alles in allem trägt der Blasmusikblog jedoch nicht direkt zu meinem Lebensunterhalt bei.
Fachzeitschriften – auch Verbandszeitschriften – kommen durch das große Online-Angebot und die zunehmende Digitalisierung in Zugzwang. Viele Blasmusikverbände sind schon dazu übergegangen, ihre Verbandszeitschriften online anzubieten. Es ist heute quasi schon Standard und der Markt verlangt das. Wie die Verbände aber zukünftig dieses Angebot dann noch finanzieren können, ist mir schleierhaft… Dem Internet haftet halt eine Gratis-Mentalität an…
Nun fragen sich bestimmt viele Leserinnen und Leser, warum ich trotzdem das Angebot des Blasmusikblogs aufrechterhalte: Mit dem Blasmusikblog positioniere ich mich als Kennerin der Blasmusikszene und der Musikvereine. Ich freue mich über jede Anfrage von einem Blasmusikverband für einen Workshop zu den Themen Zukunft der Musikvereine, Marketing für Musikvereine, Mitglieder finden und binden, Teambasiertes Vereinsmanagement oder Auftakt zu einer begeisternden Jugendarbeit sowie über jede Anfrage von einem Musikverein für eine Zukunftswerkstatt oder die Umstrukturierung zum Teambasierten Vereinsmanagement. Auch Anfragen für mein „Kurzprogramm“ für kleinere Verbandsanlässe oder Hauptversammlungen sind willkommen: Das musikalische Speed-Dating „Allegro con fuoco“ zu vorher festgelegten Musikvereinsthemen machen großen Teilnehmer:innen-Gruppen extrem viel Spaß und bringen enorm viel Input und Ideen für die Vereinsarbeit.
Übrigens, kleiner Side-Fact: Für einen Blogbeitrag brauche ich vom ersten Schreiben bis zur Veröffentlichung, inklusive dem Verbreiten in den Social-Media-Kanälen, in der Regel zwischen sechs und acht Stunden, bei manchen Beiträgen können es auch schon mal 10 Stunden sein. Nicht mit eingerechnet ist die Denk- und Recherchearbeit bevor ich mit dem Schreiben beginne…”
Helmut: Du hast aufgrund deiner langjährigen Erfahrung einen unglaublichen Überblick: Wie hat sich die Szene der Blasorchester in Mitteleuropa entwickelt, gibt es aus deiner Sicht regionale Unterschiede und was ist nach deiner Wahrnehmung positiv oder auch kritisch zu sehen?
Alexandra: “Das ist eine unheimlich große Frage. In Teilen habe ich sie schon in den Interviews von Stephan Niederegger, Ralf Eckert, Sandra Settele und Henning Klingemann beantwortet. An dieser Stelle deshalb noch ein paar andere Aspekte zur Entwicklung der Blasorchesterszene in Mitteleuropa bzw. dem deutschsprachigen Europa.
Fangen wir mal mit den Dirigentinnen und Dirigenten an. Sie sind schließlich die Schlüsselfiguren im Spiel. Erfreulich ist, dass wir immer mehr professionell ausgebildete Dirigentinnen und Dirigenten haben. Einer der wichtigsten Parameter zur Zukunftssicherung unserer Musikvereine bzw. Blasorchester ist die Steigerung der Qualität in der Musik. Je mehr top ausgebildete Dirigent:innen wir haben, desto besser werden die Blasorchester. In der Beobachtung der Blasorchesterszene sehe ich bei den Dirigentinnen und Dirigenten tatsächlich in Österreich, Südtirol und der Schweiz eine viel bessere Entwicklung als in Deutschland. Ich führe das auf die bessere Basisausbildung (vor Studium) der Dirigent:innen in diesen Ländern zurück. Sicherlich hat auch das Blasmusikforum in Ossiach, viele Dirigenten-Workshops und -Fortbildungsveranstaltungen in diesen beiden Ländern und der Schweizer Dirigentenverband BDV einen großen Anteil daran.
Die Qualität der Blasorchester hängt natürlich nicht nur vom Dirigenten/der Dirigentin ab, sondern auch von der Ausbildung der Musiker:innen. Was ich beobachte ist, dass da, wo die Musikvereine eine gut gehende Kooperation mit der Musikschule haben, die besseren Blasorchester sind. Beste Beispiele hierfür sind das Symphonische Blasorchester Kreuzlingen (CH), die Stadtkapelle Wangen (DE), die Stadtmusik Stockach (DE), Deine Stadtmusikkapelle Landeck (AT) und sehr viele weitere mehr.
Eine gute Bezahlung der Dirigent:innen ist die logische Konsequenz der guten Aus- und Fortbildung. Hier sehe ich tatsächlich überall in Mitteleuropa Nachholbedarf. Die Zeit der ehrenamtlichen Dirigent:innen ist definitiv vorbei. Selbstverständlich auch die Zeit der dirigentisch unausgebildeten Trompeter, die man vorne dran stellt, weil sie gute Musiker sind. Lach bitte nicht, das kannst Du in Deutschland tatsächlich erleben…
Ein Parameter zur Zukunftssicherung der Blasorchester bzw. Musikvereine ist die Steigerung der Qualität im Vereinsmanagement. In Österreich habt Ihr schon sehr lange die Lehrgänge für Vereinsfunktionäre und der Jugendreferenten. Damit wart Ihr in Österreich sicherlich die Vorreiter in Mitteleuropa. In der Schweiz sehe ich diese Ausbildung nicht und in Deutschland nur punktuell in Ansätzen bei manchen Verbänden (wir haben keine einheitliche Verbandslandschaft wie Ihr in Österreich) – aber nicht kontinuierlich und strukturell verankert wie bei Euch. Nachholbedarf im zeitgemäßen und zukunftsgerichteten teambasierten Vereinsmanagement haben alle Länder. Es sind noch viel zuviele Vereine traditionell, hierarchisch strukturiert.
In den letzten 10 Jahren ist die Anzahl an Wertungsspielen und Wettbewerben in Deutschland zurückgegangen. In Österreich und der Schweiz sehe ich das nicht. Im BDB (die badischen Musikvereine in Baden-Württemberg) werden sogenannte „Wertungsspiele vor Ort“ durchgeführt. Die Musikvereine können Juroren zum Konzert einladen und sich beurteilen lassen. Diese Idee wurde wohl aus der Not geboren, weil sich die Musikvereine in der Vergangenheit nicht mehr zu den Wertungsspielen angemeldet haben. Es kann ja sein, dass das Jurorengespräch nach dem Konzert dem Musikverein etwas bringt. Aber es fehlen entscheidende Faktoren, die bei einem Wertungsspiel, bei dem viele Blasorchester antreten, den Wert ausmachen: Das Treffen auf und mit anderen Musikvereinen, der Blick über den Tellerrand hinaus sowie die Aufmerksamkeit des Gehörs, was denn andere Blasorchester so machen, wie diese musizieren. Außerdem fehlt dabei ein gesunder Sportsgeist, der für die Szene sehr bereichernd sein kann. Ganz davon abgesehen, dass ein Austausch und die Party mit Musiker:innen verschiedener Musikvereine komplett fehlt. Anstatt zu analysieren, warum sich die Musikvereine nicht mehr zu den Wertungsspielen im Verband anmelden und daraus Verbesserungen abzuleiten, hat man sich hier eine Alternative überlegt, die meines Erachtens weit weniger wertvoll ist. Wie schon im Interview mit Ralf Eckert angemerkt hätte ich da Ideen, aber die werde ich irgendwo an anderer Stelle im Blasmusikblog mal vorstellen. Ist ja nicht vorrangig meine Aufgabe sich darüber Gedanken zu machen.
Mit Woodstock der Blasmusik hat die Blasmusik einen Hype in einem speziellen Sektor der Blasmusik erhalten: In der traditionellen Blasmusik. Gleichzeitig hat Woodstock dafür gesorgt, dass die kleinen Blaskapellen-Besetzungen mit überwiegend traditionellen, aber auch unterhaltendem Repertoire überall im deutschsprachigen Europa aus dem Boden schießen. Woodstock hat die Blasmusik partyfähig gemacht. Ich nenne deshalb die Musik, die dort überwiegend gespielt wird, Halligalliblasmusik. Mein Sohn und auch viele andere sind davon überzeugt, dass Woodstock und ähnliche Festivals (es gibt mittlerweile ja so viele Nachahmer) auch die Blasorchesterszene, die überwiegend konzertant bzw. „sinfonisch“ unterwegs ist, beflügelt. Eindrücklich hat Lukas das in seinem Beitrag Woodstock der Blasmusik, mehr als nur „Uftata“-Musik?! beschrieben. Ich habe jedoch auch diejenigen im Ohr, die sagen, dass diese Art der Blasmusik Musiker:innen abzieht, die dringend in den großen Blasorchestern – auch Auswahlorchestern – gebraucht werden. Das kann man nun beklagen. Das ist die eine Variante. Wir, also diejenigen, die die “großen Blasorchester-Kisten“ lieben, können aber auch anders darauf reagieren. Nämlich mit der Frage, wie machen wir uns noch viel attraktiver? Anstrengender und anspruchsvoller ist die Sinfonische Blasmusik, das ist sicher. Für Werke, die in diese Kategorie fallen, muss sicherlich mehr geübt und geprobt werden als für jede Polka. Hoffen wir, dass nicht alle Musiker:innen zukünftig den vermeintlich leichteren, spaßigeren Weg gehen wollen.
Die Förderung der Blasorchester-Komponisten in der Schweiz und Österreich hat die jeweils örtliche Szene in den letzten Jahrzehnten bereichert. In Deutschland hinken wir dieser Entwicklung nach. Ausführlich habe ich darüber in den Interviews von Sandra Settele und Henning Klingemann geschrieben.”
Helmut: Wo liegen für Amateurvereine deiner Meinung nach die größten Herausforderungen und welche Hilfestellungen können/sollen die Blasmusikverbände anbieten?
Alexandra: “Diese Frage ist für mich sehr leicht zu beantworten. Das ist mein Spezialgebiet. Erstens weiß ich das aus unzähligen Zukunftswerkstätten, die ich in Musikvereinen in Deutschland, Österreich und der Schweiz durchgeführt habe, andererseits habe ich das wieder schwarz auf weiß in der Umfrage zur „Zukunft der Musikvereine“, die gerade und bis noch zum 30. September läuft.
Die größte Herausforderung ist, Kinder und Jugendliche für das Spielen eines Blas- oder Schlaginstruments zu begeistern, gefolgt von der Frage: „Wie schaffen wir es, dass die Kinder und Jugendlichen, die ein Blas- oder Schlaginstrumente lernen, letztendlich auch in unseren großen Blasorchestern (Hauptorchester, Stammorchester, oder ähnliche Bezeichnungen) ankommen?”
Weiter, es wird immer schwieriger, Personen für Vorstandsämter zu gewinnen, die mit vielen Aufgaben und viel Verantwortung beladen sind.
Danach folgen weitere Herausforderungen: Eine:n geeignete:n Dirigent:in finden, ein adäquates Probelokal finden, unterschiedliche Motivationen im Orchester bis hin zu Disziplinproblemen (Probenbesuch, -aufmerksamkeit, Zuverlässigkeit) und persönlichen Differenzen (es wird von Quertreibern, Bruddlern und Nörglern gesprochen).
Dies sind tatsächlich schon erste Ergebnisse der momentanen Umfrage. Übrigens: Das waren schon die größten Herausforderungen, wie sie auch in meiner Umfrage aus dem Jahr 2015 genannt wurden. Seither hatten wir Corona und auch die persönlichen Lebensumstände und Freizeitgewohnheiten haben sich in den letzten 10 Jahren extrem geändert. Es wird also nicht leichter.
Kommunikation (auch Austausch zwischen den Musikvereinen), Aus- und Fortbildung sowie Marketing sind die Rezepte, die uns in der Blasorchesterszene helfen und auf die sich meiner Meinung nach die Blasmusikverbände konzentrieren sollten. Wobei es in dieser Hinsicht, lieber Helmut, im Österreichischen Blasmusikverband nichts zu meckern gibt…”
Helmut: Wo siehst du die größten Stärken eines Blasmusikverbandes und welche Schwächen offenbaren sich aus deiner Sicht?
Alexandra: “Ich fang bei dieser Frage zuerst mit den Schwächen an. Die Verbandslandschaft ist überwiegend ehrenamtlich geprägt. Wie diese Ehrenämter ausgeführt werden liegt in der jeweiligen Persönlichkeit. Ehrenamt findet nur in der jeweiligen Freizeit statt und Ehrenamt muss man sich leisten können. So löblich es ist, dass wir so wahnsinnig viele tolle Ehrenamtliche haben, so sicher ist es, dass diese ihre Aufgaben nur wahrnehmen können, wenn sie Zeit dafür haben und auch die nötigen finanziellen Mittel aufbringen können. Ein großes Stück weit sind wir auch auf den Goodwill der einzelnen Persönlichkeiten angewiesen. Und dann gibt es vereinzelt halt auch diese Ehrenamtlichen, die dann doch nur die eigenen Interessen im Blick haben.
Wir könnten nun sagen, dass wir mehr Hauptamtliche brauchen. Das könnte eine Lösung sein. Vielleicht eine sehr gute, wenn der Blasmusikverband sich das leisten kann und will.
Die Zusammenarbeit von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen ist nicht immer konfliktfrei. Die Hauptamtlichen sind oft nicht die Entscheidungsträger, sondern die Präsidien oder gar der jeweilige Präsident. Dementsprechend sind die Hauptamtlichen auf Informationen und Entscheidungen der Ehrenamtlichen angewiesen. Frust entsteht da, wo die Ehrenamtlichen zu lässig mit dieser Tatsache umgehen und die Hauptamtlichen „hängen“ lassen.
Die größte Stärke eines Blasmusikverbandes sind die gebündelten Kräfte. Dass ich mit der Blasmusikverbandslandschaft in Deutschland nicht glücklich bin, wissen alle, die das Interview von Ralf Eckert gelesen haben oder mein Interview im Radiosender SWR Kultur vom 14. September (https://www.swr.de/swrkultur/musik-klassik/wo-drueckt-der-schuh-alexandra-link-zur-blasmusikerinnen-umfrage-2025-100.html ) gehört haben. Im Interview mit Ralf Eckert habe ich beschrieben, wie ich mir eine Blasmusikverbandslandschaft in Deutschland vorstellen würde. Österreich und die Schweiz beweisen, dass ihre jeweiligen Strukturen mit einem starken nationalen Dachverband und Landesverbände auf Bundesland- bzw. Kantonsebene zeitgemäß, handlungsfähig und innovativ sind.”
Herzlichen Dank lieber Helmut für die interessanten und herausfordernden Fragen!
Übersicht über die 10 Interviews:
1/10 Fragen von Roman Gruber
2/10 Fragen von Klaus Härtel
3/10 Fragen von Sandra Settele
4/10 Fragen von Mark Baumgartner
5/10 Fragen von Stephan Niederegger
6/10 Fragen von Ralf Eckert
7/10 Fragen von Andreas Kleinhenz
8/10 Fragen von Henning Klingemann
9/10 Fragen von Petra Springer
10/10 Fragen von Helmut Schmid