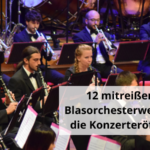Jubiläumsinterview 3/10 zu 10 Jahren KSL und Blasmusikblog
Die Fragen stellt: Sandra Settele
In den 10 Jahren, die der Blasmusikblog und meine Firma Kulturservice Link schon bestehen, habe ich vielen Persönlichkeiten Fragen gestellt. Sowohl für den Blasmusikblog in unzählichen Round-Up-Posts und Interviews als auch in meinen Workshops und Zukunftswerkstätten. Zu meinem Jubiläum drehe ich den Spieß um und lasse mir Fragen stellen.
Die Fragen in diesem dritten Interview stellt Sandra Settele. Sandra ist Verbandsdirigentin im Allgäu Schwäbischen Musikbund ASM und Chefdirigentin Stadtkapelle Germering
Sandra: Gibt es einen Schlüsselmoment, an dem klar wurde: Musik wird mein Lebensinhalt?
Alexandra: “Nicht einen, eher eine Reihe von Schlüsselmomenten. Oder eher „Schlüsselmöglichkeiten“. Es fing schon damit an, dass ich 1989 eine Lehrstelle als Musikalienhändlerin bei Musik Gillhaus in Freiburg bekommen habe, ohne dies geplant zu haben. Weiter ging es mit dem Angebot von De Haske bei der Musikmesse 1996 die deutsche Niederlassung aufzubauen. Und nach meiner Tätigkeit bei De Haske die Empfehlung eines Karriereberaters: „Sie machen sich selbstständig. Sie nutzen Ihr Netzwerk!“. Das war die Initialzündung, um über meinen Kulturservice Link nachzudenken. Soweit mein beruflicher Lebensinhalt.
„Privat“ wurde meine absolute Leidenschaft für die Blasmusik schon sehr viel früher geweckt. Die Entdeckung des Repertoires von Henk van Lijnschooten/Ted Huggens in den 80er-Jahren spielte dabei eine Rolle. Außerdem hatten der Gold-Kurs in Waldau, der C2- und anschließende C3-Lehrgang einen großen Anteil. Dort legte ich die ersten Fundamente meines Netzwerks. Ein Netzwerk, das ich bei Musik Gillhaus und erst recht bei De Haske erweitern konnte. Mit einigen Menschen aus den oben genannten drei Kursen bin ich noch heute freundschaftlich verbunden.
Erste persönliche internationale Kontakte hatte ich übrigens schon bei Musik Gillhaus: Anfang der 90er Jahre durfte ich bei einer Holland-Reise den Molenaar-Verlag besichtigen und ich verbrachte einen tollen Dinner-Abend mit Ilse und Bob Molenaar in Volendam. Im Jahr darauf haben mir Ilse und Bob eine Ferienwohnung in Bergen aan Zee vermittelt. Wir haben uns in diesen Ferien natürlich auch wieder getroffen und sie haben mich spontan zur Geburtstagsfeier einer ihrer Töchter eingeladen, außerdem zu einem Abend, an dem Ilse eine indonesische Reistafel für mich vorbereitet hat (Ilse stammt aus Indonesien). In diesen Ferien, es war 1995, hatte ich auch die Gelegenheit den neuen Firmensitz von De Haske in Heerenveen zu besichten. Jan de Haan selbst führte mich durch das Gebäude und wir haben lange miteinander über Blasorchesterrepertoire geredet. Curnow Music Press war damals das neue De-Haske-Label und Jan stellte mir die ersten Werke, die in diesem Verlagszweig erschienen sind, vor. Auch eine Orchesterwoche im Jahr 1995 hat dazu beigetragen, dass Musik mein privater und beruflicher Lebensinhalt wird. Gastdirigent war damals Johan de Meij. Seither sind wir freundschaftlich verbunden. (Hey, Johan, wir kennen uns schon 30 Jahre!!!)”
Sandra: Welcher Dirigent/in, Komponist/in hat dich nachhaltig beeindruckt – und warum? Gibt es eine Situation oder ein bestimmtes Erlebnis?
“Da muss ich gar nicht lange überlegen. Es gibt drei Dirigenten:
Bernhard Volk
Im Jahr 1991 habe ich zusammen mit einer Gruppe von Gleichgesinnten das Markgräfler Verbandsblasorchester gegründet. Jürgen Markwart, einer der „VBO-Aktivisten“, kannte Bernhard vom Landesblasorchester Baden-Württemberg und sagte uns, dass wir keinen besseren Dirigenten als ihn haben könnten. Bernhard war damals erst Mitte 20 und Jürgen hatte recht! Es waren fantastische sechs Jahre mit ihm als Dirigent des Markgräfler Verbandsblasorchesters und ich habe viel gelernt! Zwei Mal durfte ich ihn seither als Dirigent beim Projekt Benefiz – Musik und Kultur für andere erleben und einmal in der Orchesterphase zum Jubiläumkonzert zum 25-jährigen Bestehens des Markgräfler Verbandsblasorchesters im Jahre 2016, bei dem wir ein Konzert mit allen drei bisherigen Dirigenten organisiert haben. Er dirigiert momentan übrigens wieder das Sinfonische Blasorchester Norderstedt.
Douglas Bostock
Mit Douglas Bostock durfte ich bisher noch kein Konzert in einem Blasorchester spielen. Das steht noch auf meiner Bucket-Liste. Aber ich durfte ihn schon 10-mal als Dirigierlehrer erleben. Natürlich nicht als Dirigier-Studentin, sondern im Kurs-Orchester bei den Masterclasses an der BDB-Musikakademie in Staufen. Ich war bei vielen Dirigier-Lehrern Musikerin im Kursorchester, aber er ist nach meinem Empfinden mit Abstand der Beste! Seine Art und seine Gabe, Dirigenten innerhalb von drei Tagen „besser“ zu machen, finde ich sehr beeindruckend! Und ich habe – obwohl nur Musikerin – sehr viel von ihm gelernt.
Ignatius Wang
Und wenn Douglas Bostock der beste Lehrer ist, so ist Ignatius Wang sein bester (ehemaliger) Student! Schon als er zum ersten Mal beim Meisterkurs mit Douglas in Staufen war, war ich total von ihm begeistert. Er hat die Gabe, das Orchester „zu umarmen“ und es musikalisch zu Höchstleistungen zu bringen. Es ist einfach fantastisch mit ihm als Dirigent zu spielen. Gott sei Dank durfte ich ihn auch schon in einer Orchesterwoche bei Benefiz – Musik und Kultur für andere erleben! (Ignatius Wang und das Gleichnis vom Schwan)
Wenn Du nach Komponisten fragst, dann wird das schon schwieriger! Denn da gibt es so viele, die mich persönlich in meinem bisherigen Leben nachhaltig beeindruckt haben. Einerseits mit ihren Werken, andererseits aber auch als Dirigenten, wie z. B. Thomas Doss (!), Mario Bürki, James Curnow, Jan de Haan, Johan de Meij, Jan Van der Roost, Ferrer Ferran und viele weitere…”
Sandra: Was war dein spannendstes oder ungewöhnlichstes Projekt bisher?
…dein größtes musikalisches Erlebnis bisher?
Alexandra: “Die spannendsten bzw. ungewöhnlichsten Projekte bisher mit meinem Kulturservice Link waren die beiden IBK – Internationalen Blasmusik Kongresse in Neu-Ulm. Das brauche ich hier sicher nicht weiter erklären und ausführen.
Bei den musikalischen Erlebnissen gibt es, seit ich mich in der Blasmusik-Szene bewege, viele großartige Erlebnisse. Ein paar besondere, die mich extrem und nachhaltig beeindruckt haben, im Folgenden.
Mein erstes Benefiz-Projekt, das ich gespielt habe, gehört ganz sicher dazu. Dirigent war wie schon erwähnt Johan de Meij. Es war mein erstes Erlebnis in einem großen Sinfonischen Blasorchester mit einem internationalen Gastdirigenten. Wir haben u. a. die deutsche Erstaufführung von The Big Apple gespielt.
Mein erstes Eidgenössisches Musikfest im Jahr 1996 in Interlaken werde ich nie vergessen. Dort habe ich zum ersten Mal André Waignein getroffen. Das Gesamtspiel habe ich von der Dachterrasse eines Hotels beobachtet – das Bild mit all den Musiker:innen und den vielen Fahnen habe ich heute noch vor Augen.
Ende der 90er-Jahre habe ich in Schladming bei der MidEurope zum ersten Mal ein Werk von Thomas Doss gehört. Es hat mich so beeindruckt, dass ich meinen Verlagschefs damit in den Ohren gelegen habe, dass wir Thomas für unseren Verlag gewinnen sollen.
Die Uraufführung von Sinfonia Hungarica von Jan Van der Roost in Budapest im Jahr 2000 (oder 2001?) werde ich nie vergessen. Er dirigierte selbst. Es war wahnsinnig eindrücklich, weil auch der Konzertsaal so klasse war. Im zweiten Konzertteil dirigierte Johan de Meij übrigens sein Lord of the Ring. Zwischen den Sätzen las ein Schauspieler aus dem Buch (auf ungarisch, ich hab nichts verstanden).
Im Jahr 2001 begeisterte mich wie den ganzen Saal die Civica Filarmonica di Lugano beim Eidgenössischen Musikfest in Fribourg. Die letzten Klänge von Poema Alpestre waren noch nicht verklungen, sprangen die euphorischen Menschen schon von den Sitzen und jubelten der Civica zu! Natürlich hat die Civica gewonnen.
Die Europäischen Brass Band Meisterschaften im Jahr 2015 in Freiburg habe ich extrem genossen. Es war der erste EBBC, den ich erlebt habe und die musikalische Atmosphäre war großartig!
Im Jahr 2018 besuchte ich das Konzert zum 30-jährigen Jubiläum von The Lord of the Ring in Sittard, NL, und hörte zum ersten Mal in meinem Leben die Belgischen Gidsen live. Dort legte ich auch die Basis für das Konzert der Belgischen Gidsen beim IBK im Jahr 2020 – was auch zu meinen größten musikalischen Erlebnissen gehört. Jan Van der Roost hat mir damals Yves Segers vorgestellt. Beim gleichen IBK ging der langjährige Wunsch in Erfüllung, die Civica Filarmonica di Lugano einmal für ein Konzert nach Deutschland zu holen!
Zu meinen größten musikalischen Erlebnissen in letzter Zeit gehören ein paar Minuten im Orchester mit einem „kleinen“ Werk: Dem St. Florian Choral. Das war vergangenen April in Ossiach beim Blasmusikforum des Österreichischen Blasmusikverbands. Die genaue Geschichte kannst Du hier nachlesen: Ossiach: Ein Ort der Begegnung, der Freundschaft, des Musizierens.”
Sandra: Wie gelingt es alleinerziehenden Müttern, eine gesunde Balance zwischen Karriere und Familie zu finden, ohne dabei sich selbst aus dem Blick zu verlieren?
Alexandra: “Ich habe mich nie als alleinerziehende Mutter gefühlt, hatte immer eine gesunde Balance zwischen Karriere und Familie und konnte mich immer im Blick behalten – zumindest was meinen Sohn betrifft. Man sagt ja, es braucht ein Dorf, um ein Kind groß zu ziehen. Nun, ein ganzes Dorf war es bei Lukas nicht. Aber eine große Familie. Neben meiner Mutter gab es zwei weitere „Omas“ im Dorf, mein Patenonkel sowie sein Getti (mein Bruder). Sein Vater war ja auch zeitweise für ihn da. Ich konnte also immer alles machen, was ich wollte, weil immer jemand da war, zu dem er sehr gerne gegangen ist, wo er gut aufgehoben war und wo er Spaß hatte (auch als „Knecht“ seines Gettis). Rückblickend gab ihm das, zusammen mit vielen Reisen (auch geschäftlich), bei denen er dabei war (beispielsweise bei der MidEurope in Schladming als er klein war), viel Selbstvertrauen und Weitblick. Ich musste ihn nie vom Landschulheim abholen, weil er Heimweh hatte *lach*. Ich denke, er lebt nach dem gleichen Motto wie ich: „daheim sterben die Leut‘“. Er managt sein Leben inklusive Studium sehr selbstständig und selbstbewusst. Für einen 21-jährigen, denke ich, nicht selbstverständlich. Ich bin eine sehr stolze „alleinerziehende“ Mama.”
Sandra: Was macht für dich ein gutes Ensemble aus – musikalisch und menschlich?
Alexandra: “Toleranz, Teamgeist und eine gute Kommunikation sind zunächst meine spontanen Schlagwörter zur Beantwortung dieser Frage. Alle drei Faktoren gelten sowohl musikalisch als auch menschlich.
Musikalisch
- Toleranz: In einem Ensemble treffen viele verschiedene musikalische Vorstellungen, Vorlieben und Erfahrungsniveaus aufeinander. Ein gutes Ensemble zeichnet sich dadurch aus, dass man diese Vielfalt akzeptiert – sei es der unterschiedliche Musikgeschmack oder das unterschiedliche technische Können. Diese Toleranz ermöglicht es, ohne langwierige, unnötige Repertoire-Diskussionen harmonische Konzerte zu spielen.
- Teamgeist: Musizieren im Ensemble ist kein Solo. Jeder einzelne Ton bekommt erst im Zusammenspiel seinen Sinn. Teamgeist bedeutet hier: aufeinander hören, sich gegenseitig tragen, bewusst Lücken lassen oder die eigene Stimme zurücknehmen, wenn es der Musik dient. Wer Teamgeist lebt, denkt immer an das große Ganze – die Partitur als gemeinsame Sprache. Orchester geht nur gemeinsam!
- Kommunikation: Musikalische Kommunikation findet im Spielen selbst statt – durch Atmung, Blickkontakt, Körpersprache, Hören. Aber auch davor und danach: Wie sprechen wir über Interpretationen, wie finden wir Kompromisse, wie geben wir Feedback? Eine offene, respektvolle Kommunikation sorgt dafür, dass sich eine gemeinsame musikalische Idee entwickelt.
Menschlich
- Toleranz: Jedes Ensemble ist ein Spiegel der Gesellschaft: verschiedene Charaktere, Altersgruppen, Hintergründe. Toleranz heißt hier, Menschen so anzunehmen, wie sie sind – mit ihren Eigenheiten und vielleicht auch mal schwierigen Seiten. Nur wenn jeder das Gefühl hat, er darf „so sein“, entsteht ein Klima, in dem man sich wohlfühlt.
- Teamgeist: Ein Ensemble funktioniert dann gut, wenn man nicht nur musikalisch füreinander da ist, sondern auch menschlich. Ob das das Organisieren von Konzerten ist oder das gemeinsame Anpacken bei Aufgaben rund um den Verein – Teamgeist bedeutet, die Verantwortung zu teilen und gemeinsam Erfolge zu feiern.
- Kommunikation: Konflikte lassen sich in keinem Ensemble vermeiden, aber man kann lernen, offen, ehrlich und respektvoll miteinander zu sprechen. Kommunikation bedeutet auch, Wertschätzung auszudrücken, Lob zu geben und Sorgen anzusprechen, bevor sie groß werden. Sie ist die Basis für Vertrauen – und Vertrauen ist wiederum die Basis für ein gutes Miteinander.
Musikalisch zeigt sich ein gutes Ensemble daran, dass man mit Toleranz verschiedene Vorlieben bzw. Geschmäcker akzeptiert, im Teamgeist aufeinander hört und durch offene Kommunikation eine gemeinsame Interpretation entwickelt. Menschlich zeigt sich ein gutes Ensemble in der Fähigkeit, die Vielfalt an Charakteren zu tolerieren, im Teamgeist füreinander einzustehen und durch eine offene Kommunikation Vertrauen und Zusammenhalt zu schaffen.”
Sandra: Was treibt dich an, dich fürs Ehrenamt, für unsere Blasorchesterszene so intensiv zu engagieren?
Alexandra: “Ich habe in drei Musikvereinen, in denen ich gespielt habe, die Erfahrung gemacht, dass Vorstände bzw. Vorstandschaften die musikalische Entwicklung hemmen oder vorantreiben können. Wie Du weißt, ist Blasmusik, vor allem die konzertante bzw. sinfonische, meine Leidenschaft. Aber um tolle Konzerte spielen zu können braucht es einen guten organisatorischen Rahmen und auch Vereinsverantwortliche, die die Qualität der Musik sowie die Zufriedenheit, Wünsche und Motivationen der Musiker:innen immer im Blick haben. Um einen Musikverein in diesem Sinne in die Zukunft zu führen, braucht es Strukturen, Prozesse und Systeme, die nicht komplett von den wirtschaftlichen Faktoren blockiert sind, sondern Freiräume bieten, um nach vorne zu denken. Letztendlich werden Blasorchester nur dann Bestand haben, wenn Mission, Qualität und Wirtschaftlichkeit sich gegenseitig positiv beflügeln. Es braucht also gute Organisations- und Verwaltungsstrukturen. Ich unterstütze die Musikvereine, die sich darin verbessern möchten und zur Analyse und Selbstreflektion bereit sind.
Die kurze Antwort ist: Es macht einfach viel Spaß und die Aufgabe ist sehr erfüllend!”
Sandra: “Wie kann man junge Menschen nachhaltig für das Vereinsleben und das Mitmachen in Musikvereinen begeistern?
Alexandra: “Ich fasse diese Frage zunächst „außermusikalisch“ auf.
Wir können immer nur begeistern, mit dem was wir tun. Niemals durch Argumente. Oftmals reicht es in der Vereinsarbeit schon, ein gutes Vorbild zu sein. Dazu gehört auch, dass wertschätzend und positiv miteinander kommuniziert wird. Hilfreich ist es, wenn wir selbst lieben, was wir tun und wir Vereinsarbeit (Organisation, Verwaltung und Arbeitseinsätze zur Mittelbeschaffung) nicht als notwendiges Übel ansehen. Wie Vereinsleben vorgelebt wird, so werden es in der Regel die jungen Menschen übernehmen.
Viele junge Menschen möchten mitgestalten. Wir sollten sie mehr „einfach mal machen lassen“. Warum sollten wir Dinge in den Vereinen tun, nur weil wir sie immer so gemacht haben? Während ich das schreibe, habe ich schon wieder die Vorstände im Ohr, die sagen „Aber ich habe doch schließlich die Verantwortung. Ich halte meinen Kopf hin.“ Das ist eine formelle Umschreibung von „Ich sag wo’s lang geht.“ Ein Machtspiel? Diesen Vorständen rate ich dringend die Paragrafen §31a und 31b im BGB zu lesen und erinnere gerne daran, dass der Verein schließlich auch eine Haftpflichtversicherung hat. Gebt schon den jungen Menschen in den Vereinen Verantwortung. Wenn diese selbstbestimmt und selbstorganisiert handeln können wirkt sich das direkt auf die Motivation aus.
Viele Musikvereine finanzieren sich mit Anlässen, die nichts mit Musizieren zu haben. Für diese Anlässe sind Zusammenhalt und Arbeitseinsätze notwendig. Es wurde schon mal in einer Zukunftswerkstatt die Frage gestellt: „Arbeitsverein oder Musikverein?“ Darüber habe ich einen ausführlichen Beitrag geschrieben: Arbeitsverein oder Musikverein?
Deine Frage ist selbstverständlich auch musikalisch zu sehen. Zu unserem Vereinsleben gehören Anlässe in der eigenen Gemeinde. Manche nennen sie „Pflicht-Anlässe“. Du weißt, was damit gemeint ist: kirchliche Feste, die musikalisch gestaltet oder umrahmt werden gehören dazu wie auch weltliche Anlässe, wie z. B. Volkstrauertag, Bürgermeisterwahl, Neujahrs- und ähnliche Empfänge. Viele Musikvereine spielen außerdem noch „Ständerle“ für Altersjubilare oder begleiten Begräbnisse. Da können schon ganz schön viele Termine zusammenkommen. Diese Anlässe innerhalb der Gemeinde sind für uns imagebildend. Wenn wir uns als klägliches Häuflein präsentieren und dann auch noch schlecht spielen, ist das keine positive Werbung für uns als Musikverein. Diese Tatsache gehört jedoch zu den Argumenten, wie ich eingangs zu dieser Frage schon erwähnt habe. Wir können darüber im Musikverein reden, wie wichtig diese Anlässe sind, wir sollten diese Argumente jedoch nicht mahnend und mit gehobenem Zeigefinger von oben herunter kommunizieren. Zwei Empfehlungen gebe ich, wie wir auch die jungen Menschen von diesen Anlässen überzeugen. Erstens müssen auch hier die erfahrenen, langjährigen Mitglieder mit gutem Beispiel voran gehen. Zweitens empfehle ich, jeden Termin daraufhin abzuklopfen, ob es wirklich ein Termin ist, an dem es unerlässlich ist, dass der ganze Musikverein spielt. Der Termin kann eventuell ganz gestrichen werden oder wir schauen, inwieweit auch ein kleines Ensemble spielen könnte.
Schließlich und endlich sollten sich die Musikvereine in regelmäßigen Abständen selbst unter die Lupe nehmen, wie attraktiv sie für junge Leute sind. Die jungen Leute zu fragen ist ein erster Ansatz. Attraktive und kreative Events, die nachhaltig für Begeisterung sorgen und von denen jahrelang noch gesprochen wird, sind ein zweiter. Alle paar Jahre eine Zukunftswerkstatt durchzuführen sowieso. Siehe auch: Konzerte attraktiv gestalten und Blasmusik – Traditionen bewahren? Traditionen überdenken? Und Zukunftswerkstatt – Was ist das und was bringt es dem Musikverein?“
Sandra: Ein Blick in die Zukunft…
Welche Entwicklungen in der Musiklandschaft beobachtest du mit Sorge – und welche mit Hoffnung?
Alexandra: “Mit Sorge betrachte ich, dass Kinder und Jugendliche immer weniger mit Musikinstrumenten und dem aktiven Musizieren in Kontakt kommen. Es gibt viel zu wenig Gelegenheiten, sie für das aktive Musizieren zu begeistern. Und ich bin überzeugt davon, dass wir nur dann mehr Musikerinnen und Musiker in den Blasorchestern bekommen, wenn schon die Kinder durch selbst erlebtes Musizieren zum Lernen eines Instruments begeistert werden. Außerdem brauchen die Kinder gute Vorbilder. Spannende Erlebnisse mit Musik, die in ihnen auslösen: „Das möchte ich auch können!“. Die Studien zu den Themen „Musizieren macht schlau“ und „Musizieren macht glücklich“ mögen ja ganz gute Argumente für die Eltern liefern. Letztendlich brauchen wir aber auch Möglichkeiten, die Eltern für das Musizieren zu begeistern. In unseren Musikvereinen ist ganz klar ersichtlich: Wenn die Eltern musizieren, lernen die Kinder auch ein Instrument. In der Regel – Ausnahmen bestätigen die Regel – bleiben die Kinder und Jugendlichen dann auch eher dabei (bis es sie zur Ausbildung und Studium in andere Regionen zieht).
In den Zukunftswerkstätten und den Workshops sage ich immer, wenn wir möchten, dass Kinder und Jugendliche ein Blas- oder Schlaginstrument lernen, müssen wir uns mehrere Aktionen das ganze Jahr über überlegen, in denen wir die Kinder und Jugendlichen mit unseren Instrumenten und dem Musizieren in Verbindung bringen. Dafür braucht es im Musikverein mindestens fünf Personen, die sich um die Jugend kümmern.
Kinder müssen früh Musik erleben. Die musikalische Früherziehung oder Grundausbildung sehe ich eigentlich nicht als Aufgabe der Musikvereine. Dafür haben wir Kindergärten, Grundschulen und Musikschulen. Deren Aufgabe ist das. Nur, dass sie ihrer Aufgabe – aus welchen Gründen auch immer – nicht (mehr) nachkommen. Also müssen wir das tun.
Was ich noch mit Sorge betrachte: Wie wird das Musizieren und das Lernen eines Instrumentes ab 2026 in die Grundschulen integriert, wenn es die Ganztagschule flächendeckend gibt? Wie bringen sich die Musikschulen hier ein? Machen sich diese dann überflüssig oder sind sie schon soweit sich im Nachmittagsunterricht einzubringen? Wie schaffen wir Musikvereine es dann noch, uns einzubringen? Sind Kinder und Jugendliche zukünftig überhaupt noch in der Lage, sich nach der Schule ihrem Instrument zu widmen? Wie können sich da leistungsstarke Amateurmusiker:Innen und Talente positiv entwickeln? Ich sehe Freiräume, die meine Generation in der Kindheit und Jugend noch hatte, mehr und mehr verschwinden. Das macht mir Sorge.
Die Bläserklassen habe ich schon immer als Hoffnung für unsere Blasorchester-Szene gesehen. Und überwiegend ist die Entwicklung der Bläserklassen seit 1997 positiv zu sehen. (1997 = Erscheinen der deutschen Fassung von Yamaha Band Method und Beginn der aktiven Aus- und Fortbildung von Bläserklassen-Leiter:innen durch die Firma Yamaha). Nur fehlt es hier noch an der hochwertigen Ausbildung von Bläserklassenleitern an Pädagogischen Hochschulen und Musikhochschulen sowie an funktionierenden Kooperationen mit den Musikschulen für den zusätzlichen Einzel- bzw. Kleingruppenunterricht, ohne den es im System Bläserklasse nicht geht. Einzel- bzw. Kleingruppenunterricht für den qualitativ hochwertigen Fortschritt auf dem Instrument und die Bläserklassenstunde für das musikalische Gemeinschaftserlebnis, den Spielspaß im Ensemble, das Trainieren von Intonation, Klangausgleich und Zusammenspiel. Nur was man gut kann macht auch richtig viel Spaß.”
Sandra: Was wünschst du dir für die Zukunft der Blasmusikszene in Deutschland? Und was können wir von anderen Ländern lernen?
Alexandra: “Ich wünsche mir für die Zukunft der Blasmusikszene in Deutschland vor allem Mut zum Wandel bei gleichzeitigem Respekt vor unserer Tradition. Wir brauchen eine starke Nachwuchsarbeit, die Kinder, Jugendliche – aber auch Erwachsene – für das Musizieren im Blasorchester begeistert. Dafür sind moderne Vereinsstrukturen notwendig, die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen und professionelle Weiterbildung von Dirigent:innen und Vereinsverantwortlichen ermöglichen. Gleichzeitig sollte die finanzielle Basis unserer Arbeit gesichert sein, damit Qualität und Wertschätzung nicht vom Zufall abhängen. Musikalisch wünsche ich mir mehr Vielfalt im Repertoire und den Mut, neue Konzertformate auszuprobieren, die Publikum und Musiker:innen gleichermaßen begeistern. Entscheidend wird sein, dass wir uns besser vernetzen, voneinander lernen und Kooperationen leben – statt in Konkurrenz zu verharren. Kurz gesagt: eine lebendige, offene, selbstbewusste und zukunftsfähige Blasmusikszene, die zeigt, wie viel Kraft in unserer Kultur steckt.
Wenn wir den Blick nach Österreich, in die Schweiz, nach Belgien oder in die Niederlande richten, sehen wir eine Vielzahl an Ideen und Strukturen, die uns in Deutschland inspirieren können.
In der Schweiz ist es vor allem die Wettbewerbskultur, die Qualität auf allen Niveaus fördert – verbunden mit einer stark etablierten Dirigent:innenausbildung an den Musikhochschulen (Basel, Bern, Luzern, Fribourg), unterstützt durch sehr aktive kantonale Verbände, einem starken Schweizer Blasmusikverband SBV und dem Dirigentenverband BDV. Die Vergabe von Kompositionsaufträgen für die kantonalen und das eidgenössische Musikfest ist Garant für ein sich ständig erneuerndes Schweizer Blasorchesterrepertoire. Hervorheben möchte ich auch den Dirigentenwettbewerb, mitgetragen vom BDV.
Auch Österreich hat glücklicherweise einen starken Österreichischen Blasmusikverband ÖBV und teilweise extrem fortschrittliche und aktive Landesverbände. Starke Aktionen des ÖBV sind u. a. der JUVENTUS, das Österreichische Blasmusikforum in Ossiach, das Juroren-Netzwerk mit stetiger Fortbildung, die jährliche Durchführung von Kompositionswettbewerben sowie verschiedene Wettbewerbe für die Blasorchester (Konzertwertung, Kirchenmusik, Musik in Bewegung, Jugendblasorchesterwettbewerbe, Traditionelle Blasmusik). Österreich punktet mit einem nahezu flächendeckenden Musikschulsystem (Landesmusikschulwerke) und ihren starken Musikhochschulen bzw. Konservatorien: von der musikalischen Früherziehung bis hin zum Konzertdiplom gibt es dort eine durchgängige Ausbildung, die den Blasmusik-Nachwuchs durch starke Kooperationen mit den Musikkapellen nachhaltig und hochwertig sichert, außerdem die tragende Rolle in der drei- bzw. vierjährigen Dirigentengrundausbildung spielt. Dass Blasmusik in Österreich sogar als immaterielles Kulturerbe anerkannt ist, zeigt, wie hoch die gesellschaftliche Wertschätzung ist. Ergänzt wird das durch einen enormen Reichtum an historischer Literatur und die Arbeit der Pannonischen Forschungsstelle in Graz, die wissenschaftliche Grundlagenarbeit für die Blasmusik leistet.
Belgien zeigt, wie durchdachte Kooperationen aussehen können: Vereine, Musikakademien, Verbände und Gemeinden bündeln dort ihre Kräfte, um gemeinsame Jugendorchester aufzubauen – Projekte wie die „Band factory“ oder das „PlayInn“ beweisen, dass so nicht nur Kosten geteilt, sondern auch langfristige Strukturen für den Nachwuchs geschaffen werden. Der Unterricht an den Musikschulen ist nahezu kostenfrei.
Die Niederlande wiederum setzen gezielt auf Repertoireentwicklung. Hervorzuheben sind hier die Bemühungen für ein eigenständiges Repertoire für eine Besonderheit in den Niederlanden: Das Fanfareorchester. Besondere Lebensleistungen für die Blasmusik werden in der jährlichen Vergabe eines nationalen und eines internationalen BUMA-Awards gewürdigt. Eine besondere Rolle spielt das Repertoire Informatie Centrum RIC. Nicht zu vergessen ist Kerkrade der Ort, an dem alle fünf Jahre die besten der besten Blasorchester in Europa (und darüber hinaus) eine großartige Plattform bekommen. Und auch in den Niederlanden wird die Ausbildung von Blasorchesterdirigent:innen an verschiedenen Musikhochschulen bzw. Konservatorien groß geschrieben.
Was wir von all diesen Ländern lernen können, ist klar: Blasmusik braucht institutionelle Verankerung, gesellschaftliche Anerkennung, systematische Nachwuchsarbeit, gezielte Investitionen in Qualität und Repertoire sowie den Mut, Kräfte zu bündeln, statt nebeneinanderher zu arbeiten. Dort, wo diese Faktoren zusammenspielen, wird Blasmusik zu einem selbstverständlichen, lebendigen Teil des kulturellen Lebens. Und genau in diese Richtung sollten wir auch in Deutschland mutig weitergehen.”
Herzlichen Dank liebe Sandra für die sehr interessanten Fragen!
Übersicht über die 10 Interviews:
1/10 Fragen von Roman Gruber
2/10 Fragen von Klaus Härtel
3/10 Fragen von Sandra Settele
4/10 Fragen von Mark Baumgartner
5/10 Fragen von Stephan Niederegger
6/10 Fragen von Ralf Eckert
7/10 Fragen von Andreas Kleinhenz
8/10 Fragen von Henning Klingemann
9/10 Fragen von Petra Springer
10/10 Fragen von Helmut Schmid