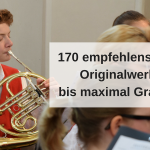Praxisbeispiel: Eine gelungene Jugendkapellen-Kooperation
JuKa-Kooperation Jugendblasorchester Bad Waldsee / Jugendblasorchester „WoWaBe“ – ein Gastbeitrag von Klaus Wachter
Der sicherste Weg für junge Blasmusikerinnen und Blasmusiker in unsere Blasorchester führt über Jugendensembles bzw. Jugendorchester. Und das von Anfang der Instrumentalausbildung an. Doch was tun, wenn der Musikverein selbst nur wenige “Zöglinge” hat? Mit den paar wenigen musizieren? Ist eine Möglichkeit. Ganz nach dem Motto: lieber ein kleines Ensembles als gar kein Ensemble-Musizieren. Doch bedenke, liebe Leserin, lieber Leser, Dein Nachbarverein oder Deine Nachbarvereine stehen vor der gleichen Herausforderung! Und eines ist sicher: Den Kindern und Jugendlichen macht es weit mehr Spaß in einem großen Ensemble, einem “echten Orchester” zu spielen, als in kleinen Ensembles – wo sich zudem keiner musikalisch verstecken kann. Die Antwort auf die Herausforderung lautet: Jugendkapellen-Kooperationen! Doch Kooperationen stellen per se auch wieder große Herausforderungen dar… die der selbstlosen Zusammenarbeit allein im Dienste der jungen Musikerinnen und Musiker.
In diesem ersten von insgesamt vier Beiträgen zum Thema Jugendkapellen-Kooperationen berichtet Klaus Wachter von einer sehr gelungenen Jugendkapellen-Kooperation der Gesamtgemeinde Bad Waldsee und Umgebung. Herzlichen Dank, lieber Klaus, für Deinen offenen Bericht, aus dem alle Musikvereine sehr viel lernen können!
Der Gastbeitrag von Klaus Wachter:

“Ich glaube, dass die Problempunkte von Juka-Kooperationen im Wesentlichen auf folgende Punkte eingeengt werden können:
- Konkurrenzdenken der beteiligten Vereine; ggf. in Verbindung mit der Angst, dass die eigenen Jugendlichen zu anderen Vereinen abwandern könnten oder andere Vereine „besser“ sind
- Struktur, Organisation und Leitung des Jugendorchesters
- Identifikation mit dem Orchester
- Mangel an Transparenz, Offenheit und fehlendes Vertrauen in die Selbstständigkeit eines Jugendorchesters
Die Anfänge des Jugendblasorchesters Bad Waldsee gehen in das Jahr 2001 zurück. Die damalige Vision – welche bis heute besteht – war die Schaffung einer gemeinsamen Plattform für die jungen Musikerinnen und Musiker der vier Musikvereine aus Bad Waldsee sowie der Jugendmusikschule. Mit diesem Ziel vor Augen wurde schließlich im Jahr 2002 durch die Musikvereine Reute-Gaisbeuren, Haisterkirch, Michelwinnaden sowie der Stadtkapelle Bad Waldsee unter dem Dach der Jugendmusikschule Bad Waldsee das gemeinsame Jugendblasorchester Bad Waldsee gegründet. Die Idee einer Kooperation entstand aus mehreren Gründen: Zum einen gab es in Bad Waldsee bisher noch nie ein gemeinsames Jugendblasorchester, während umliegende Städte längst mit guten Erfahrungen vorangegangen sind. Zum anderen war das „musikalische Loch“ zwischen Vororchester/Ausbildung und dem Einstieg ins große Erwachsenenorchester für viele Jugendliche schlicht zu groß. Wir wollten eine Plattform schaffen, in der junge Musikerinnen und Musiker auf ihrem Instrument wachsen können – sei es durch das Spielen einer 1. Stimme oder durch das gemeinsame Erleben von Gruppen- und Sozialdynamik innerhalb einer gleichaltrigen Gemeinschaft. Insbesondere das gemeinsame Erleben und Kennen-Lernen etablierte sich dann auch im weiteren Verlauf als eines der wesentlichen Ziele. Während zwischen den verschiedenen Musikvereinen gerne eine Art „Konkurrenz“ besteht, war es unser ausdrückliches Ziel, dass durch das gemeinsame JBO die Vereine näher zusammenrücken. Und dies gelang auch! Schließlich mussten die Vereine auch kooperieren, sollte dieses Projekt zum Erfolg führen.
Maßgeblicher Initiator zu dieser Zeit war Hans-Jörg „Hajo“ Leuter von der Stadtkapelle Bad Waldsee. Meiner Erfahrung nach braucht es immer jemanden, der für eine Sache begeistern kann und eine Vision hat. Hajo hatte diese Vision, viel „Feuer“ und brachte auch die anderen Vorstände der beteiligten Musikvereine dazu, das „Projekt JBO“ zu wagen. Ihm haben wir die Gründung des JBOs also zu verdanken. Zunächst tauschten sich dann also die Vorstände aus, anschließend die Jugendleiter, und schließlich wurde auch die Jugendmusikschule (JMS) sowie die Stadt ins Boot geholt, sodass die Kooperation auf breiten, stabilen Schultern stehen konnte. Zu unseren besten Zeiten hatten wir über 70 junge Musikerinnen und Musiker, die mit viel Begeisterung in unserem JBO musizierten.
Nach der Coronazeit gab es leider einen starken Einbruch in der Mitgliederzahl, sodass sich die neue Leitung dazu entschloss, weitere Musikvereine ins Boot zu holen, so dass es nunmehr zehn Musikvereine sind, die unter dem neuen Namen „Jugendblasorchester WoWaBe“ agieren. Seither konnten die Mitgliederzahl wieder stabilisiert werden.

Da sich meine aktive Zeit als Musiker und Vorstand im JBO auf die Zeit von 2002 bis 2020 konzentriert, beziehen sich meine Ausführungen auch vorrangig auf diese Zeit.
Am Anfang standen viele offene Fragen im Raum: Unter welchem Dach soll das Ganze laufen – JMS, Stadt oder Stadtkapelle? Wer übernimmt die musikalische und organisatorische Leitung? Wo sollen die Proben stattfinden, und wie lässt sich das Ganze finanziell stemmen?
Dazu kam die Herausforderung, unterschiedliche Strukturen und Denkweisen der beteiligten Vereine in eine gemeinsame Jugendarbeit zu bündeln. Gerade weil jeder Verein eigene Traditionen, Abläufe und Prioritäten mitbringt, war das Finden eines gemeinsamen Weges nicht immer einfach. Aber genau dieser Prozess hat uns gezwungen, früh sehr offen und lösungsorientiert miteinander zu kommunizieren.
Ich möchte deshalb nachfolgend einige Erfolgsfaktoren beschreiben, die aus meiner Sicht für das Gelingen unseres gemeinsamen Jugendblasorchesters von besonderer Bedeutung waren:
1. Regelmäßige und transparente Kommunikation / Mitverantwortung / Gemeinsamer Ausschuss
Von Anfang an war es für uns selbstverständlich, ein gemeinsames Gremium mit allen Jugendleitern, dem Dirigent und einigen Musikern aus dem Orchester zu etablieren. Das JBO Bad Waldsee zeichnete sich immer schon durch eine hohe Selbstständigkeit aus. Aus dem Orchester heraus wurden verschiedenen Positionen etabliert, um den Musikerinnen und Musikern einen kleinen Teil der Verantwortung zu übertragen (z.B. Probenstatistik, Materialwart, Homepage usw…). Geleitet wurde dieser Ausschuss vom „Manager“. Das war quasi der Vorstand, den wir aber nie so genannt haben, da wir kein eingetragener Verein sind. Ich durfte diese Rolle zehn Jahre lang mit viel Freude ausüben. Die Vereine haben ihre Jugendleiter in den Ausschuss entsandt; manchmal waren auch die Vorstände mit dabei. Die Jugendmusikschule war als zentrale Ausbildungsorganisation ebenfalls beteiligt.
So entstand also ein JBO-Ausschuss mit rund 15 Personen, der alle zwei Monate tagte. Dabei ging es im Wesentlichen um dieselben Themen, die auch ein normaler Musikverein bespricht: Probenplanung, Veranstaltungen, Finanzfragen, musikalische Ziele usw. Entscheidungen konnten häufig souverän gefällt werden, es war nicht mehr notwendig, die „Genehmigung“ der Vereinsvorstände einzuholen. Somit konnten wir auch ein eigenes Budget verwalten (welches allerdings in Abstimmung mit Kassier Hajo Leuter immer über das Konto der Stadtkapelle abgewickelt wurde), d.h. wir waren auch verantwortlich für eine ausgeglichene Kasse, aus der wir z.B. die Bezahlung des Dirigenten, die Anschaffung der Poloshirts, Konzertkleidung, Orchesterreisen usw. finanzieren mussten. Auch hier wurde uns also eine hohe Souveränität zugestanden!
Das Besondere war, dass diese Ausschusssitzungen auch immer eine Drehscheibe für die Musikvereine bzw. deren Jugendleiter waren. Die Jugendleiter konnten (und mussten!) sich so regelmäßig treffen und besprechen. Gleichzeit war das JBO aber immer auch der Aufhänger und Anlass für eine enge Kooperation. Der Konkurrenzgedanke spielte plötzlich nur noch eine sehr untergeordnete Rolle. Die Ausbildung der Musikerinnen und Musiker sowie das Hinarbeiten auf gemeinsame (musikalische und außermusikalische) Ziele waren Hauptgegenstand unserer Arbeit.
Rückblickend glaube ich, dass diese von den Musikvereinen zugestandene Selbstständigkeit und Souveränität ein wesentlicher Erfolgsfaktor war. Wir wurden in unserer Arbeit eigentlich nur selten eingebremst. Diese „Selbstverwaltung“ führte zu einem sehr hohen Autonomieerleben und das nutzten wir selbstverständlich für unsere Ziele und Visionen.
2. (Musikalische) Ziele und Visionen
Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg sind „Highlights“, die man als Verantwortlicher setzen muss. Ein JBO lebt davon, den Musikerinnen und Musikern besondere Erlebnisse zu bieten, die im Heimatverein so nicht ohne weiteres erlebbar sind. Für uns waren das zum einen immer musikalische Zielmarken, die wir uns gesetzt haben. Neben einer jährlichen Wertungsspielteilnahme (die für uns selbstverständlich war), wollten wir aber auch die weite Welt erkunden. Und so unternahmen wir auch Reisen nach Riva zum Flicorno d’Oro (2012) und nach Schladming zur MidEurope (2015), aber auch die internationalen Jugendkapellentreffen (z.B. in Liggersdorf, Eriskirch oder Wolfurt) waren für uns fester Bestandteil. Zudem gibt es in unserer Region auch eine Veranstaltung, die sich „Oberschwäbisches Jugendmusikfestival“ nennt. Hierbei dürfen immer die punktbesten Orchester der Jugendwertungsspiele aus den Kreisverbänden Ravensburg, Biberach, Sigmaringen und dem Bodenseekreis teilnehmen. Hier durften wir 2016 den Sieg einfahren.
Besonders prägend in meiner Zeit als Manager (Vorstand) beim JBO war die Zeit mit unserem damaligen Dirigenten Dietmar Ruf (2009 – 2016). Er war hier als musikalischer Leiter besonders prägend für das Orchester, da er immer besondere und auch außergewöhnliche musikalische Ziele vor Augen hatte. Und schließlich führte er das Orchester zu einer beachtlichen musikalischen Leistung.
Zum anderen waren aber auch eigene Veranstaltungen für uns von Bedeutung. So organisierten wir in den frühen 2000er Jahren eigene Partys, um unsere Kasse aufzubessern. Zum 10-jährigen Jubiläum unseres JBOs fand 2012 der Tag der Bläserjugend des Blasmusikkreisverbandes Ravensburg in Bad Waldsee statt. Hier waren über 1.200 junge Musikerinnen und Musiker zu Gast bei uns und absolvierte ihre Wertungsspiele in Einzel- und Ensemblevorträgen. Außerdem waren zahlreiche weitere Jugendkapellen am Wertungsspiel beteiligt. Für uns war das wie ein „kleines Kreisverbandsmusikfest“. Warum ich darüber schreibe? Weil das auch für eine starke Identifikation und Außenwahrnehmung sorgt (siehe unten).
3. Führungspersonen und Kontinuität
Ein dritter entscheidender Punkt ist für mich eine gewisse Kontinuität und eine hohe Führungskompetenz. Der erfolgreiche Aufbau und die Führung eines Jugendorchesters ist auch mit einer hohen Kontinuität in den Leitungsebenen verbunden. Ich stelle bei vielen Jugendorchestern fest, dass hier „irgendein“ Jugendleiter die Führung innehat. Bitte nicht falsch verstehen: Jeder, der sich einbringt, ist gerne gesehen. Wir brauchen diese Personen. Häufig sind die Verantwortlichen aber selbst sehr jung, unerfahren und nicht mit dem notwendigen Selbstvertrauen ausgestattet, das es in dieser Position benötigt. Und gerade bei der Gründung eines Jugendorchesters kommen doch schnell sehr viele unterschiedliche Meinungen, Ansichten und „Ratschläge“ zusammen. Für unser JBO war es ein Glücksfall, dass wir mit der notwendigen Selbstständigkeit ausgestattet waren, und so sehr selbstbestimmt agieren durften. Ein weiterer Glückfall waren unsere Dirigenten, die allesamt enorm beeindruckende Persönlichkeiten waren und entsprechend begeistern konnten.
4. Außenwahrnehmung
Einen letzten Punkt möchte ich noch ausführen. Als Dietmar Ruf und ich ab 2009 das JBO leiten durften, war für uns schnell klar, dass auch die Außenwahrnehmung ein entscheidender Faktor für den Erfolg des Orchesters ist. Ein Punkt, der hier relevant ist, ist die Öffentlichkeitsarbeit. Regelmäßige Berichte in der Presse und regelmäßiger Content in Social Media sind bedeutende Aspekte der Außenwahrnehmung. Hier braucht es Menschen, die regelmäßig, ohne ständige Aufforderung und intrinsisch motiviert zu Werke gehen.
Aber auch das Erscheinungsbild spielt eine Rolle. Wie soll denn ein Jugendblasorchester auftreten? Muss es immer nur das Polo-Shirt/T-Shirt sein? Oder darf es auch mal etwas eleganter sein? Wir jedenfalls sind zweigleisig gefahren: Unterm Jahr hatten wir ab 2009 ein grünes Polo-Shirt, für Konzert und Wettbewerbe waren wir schwarz mit grünem Accessoire (Krawatte/Schal) gekleidet. Die Corporate Identity („JBO-Grün“) war somit gewahrt. Die Rückmeldungen hierzu waren durchweg positiv konnotiert und somit war für eine sehr hochwertige Außenwahrnehmung gesorgt.
5. Die Identifikation mit dem Orchester
Dieser Punkt war bereits Bestandteil der oben geschilderten Aspekte. Eine hohe Identifikation haben wir stets erreicht, in dem wir ein starkes und einheitliches (professionelles) Auftreten nach Außen hatten. Aber auch die Einbindung der Orchestermitglieder in die Entscheidungsprozesse („JBO-Ausschuss“) sorgt für eine hohe Identifikation. Nicht zuletzt sind aber auch die musikalischen Ziele von hoher Bedeutung, denn um auf einem Wettbewerb wie in Riva oder Schladming erfolgreich bestehen zu können, bedarf es eines enorm starken Zusammenhalts. Ich führe diese Punkte aber hier nochmals auf, da ich gerade dies in jüngster Zeit als zunehmend problematisch empfinde. Nicht zuletzt wollen wir unsere Musikerinnen und Musiker ja auch langfristig an unsere Vereine binden. Seit Corona scheint mir die Bindung und Verbindlichkeit aber zunehmend abhanden zu kommen. Dagegen müssen wir anarbeiten!
Wir hatten also schließlich eine großartige Zeit im JBO Bad Waldsee. Spannenderweise waren 2001 noch Fragen wie „Wo proben wir“ von großer Bedeutung. Anfangs wurde dann auch „rotierend“ geprobt, d.h. jede Woche in einem anderen Proberaum. Ziemlich schnell war klar, dass dieses System nicht nur unnötig kompliziert ist und für Verwirrung sorgt, sondern auch keine richtige Identifikation schafft. Wo gehören wir eigentlich hin? Und so war ab 2002 klar: Wir proben zentral im Probelokal der Stadtkapelle. Und das hat seither auch niemanden mehr gestört.
Interessant ist auch, dass es bei uns noch nie eine schriftliche Kooperationsvereinbarung gab. Wir wussten genau, was wir wollten und die erforderlichen Strukturen haben sich sehr schnell etabliert.
Nicht unterschlagen möchte ich aber auch einige Probleme, die immer wieder zutage traten. Da war zum einen die unterschiedliche Einstiegshürde, die die Musikvereine sich selbst auferlegt haben. Es gab Vereine, die hatten gar keine Eintrittsbeschränkung, bei anderen war der D1 oder der D2 Voraussetzung. Nun wollten aber auch wir für das JBO ein „Mindestniveau“ definieren, aber wo sollte dieses liegen? Schnell war uns klar, dass wir auch hier stärker kooperieren müssten, also organisierten wir eine gemeinsame D1-Vorbereitung und bekamen vom Blasmusikkreisverband einen separaten D1-Prüfungstermin zugewiesen. Dies funktioniert nun schon seit vielen Jahren nach dem immer gleichen Muster. Das JBO war hier also umgekehrt Impulsgeber für eine weitere Kooperation im D1-Bereich. Hier sieht man, welche Wirkung ein kooperatives Jugendorchester haben kann. Zwei Vereine haben dann den D2 als Eintrittsvoraussetzung übernommen, um eine Progression in der musikalischen Entwicklung zu ermöglichen, bei den anderen beiden war der D1 weiterhin gesetzt. Schließlich stellte sich dies aber nie als wirkliches Problem heraus.
Ein weiteres Problem, das weiterhin bestand, waren die teils vereinseigenen Vororchester, die in Bezeichnungen wie „Jugendkapelle“ des Öfteren als Konkurrenz zum JBO angesehen wurden. Dabei war die Ausbildungskonzeption eigentlich überall gleich: Instrumentalausbildung – Vororchester – JBO – Musikverein. Wenn allerdings schon vereinsintern nicht abgegrenzt wird, was der Unterschied zwischen „Jugendkapelle“ und „Jugendblasorchester“ ist, so ist es auch schwierig, zwischen diesen Ensembles zu unterscheiden, wenn man sich nicht richtig damit beschäftigt. Hier sieht man wieder einmal: Auch die Namensgebung ist entscheidend!
Auch die Finanzierung des Orchesters war immer eine Herausforderung für uns. Zwar stand uns ein (kleiner) Fixbetrag von der Jugendmusikschule und den Musikvereinen zur Verfügung, aber dies reichte i.d.R. nicht, um alle Ausgaben zu finanzieren. Wir entschieden uns schließlich für ein Modell, das einen fixen Grundbetrag sowie einen variablen Pro-Kopf-Beitrag (2€ pro Mitglied) vorsah. Vereine mit mehr Mitgliedern waren also etwas stärker belastet als Vereine mit wenigen Mitgliedern. Unterm Strich waren dies aber keine großen Differenzen. Die Vereine haben diese Regelung auch positiv aufgefasst, da sie vom Grundsatz her gerecht war.
Fazit
Rückblickend kann ich sagen, dass das JBO nicht nur musikalisch ein Erfolgsmodell war, sondern auch insbesondere hinsichtlich der besseren Vereinskooperation. Die damaligen Mitglieder der unterschiedlichen Vereine sind heute zum Teil selbst Vorstand, Jugendleiter, Kassier oder in anderen verantwortlichen Positionen ihrer Heimatvereine. Und man kooperiert immer noch!
Erfolgsfaktor Nummer eins ist die klare Einsicht aller Beteiligten, dass es nicht um Einzelinteressen, sondern um die Zukunft der gesamten Blasmusik in unserer Region geht. Der Mut, alte Strukturen aufzubrechen und Neues zu wagen, hat sich gelohnt. Außerdem war es entscheidend, dass Vorstandschaften, Jugendleiter, Stadt und JMS von Anfang an eingebunden waren – so trägt jede Seite Verantwortung und bringt ihre Stärken ein.
Mein Tipp
Geht den Weg gemeinsam und mit Offenheit. Sprecht ehrlich über eure Erwartungen, Herausforderungen und Ängste. Lasst die Jugendlichen selbst zu Wort kommen – ihre Sichtweise auf Gemeinschaft, Motivation und Spaß ist oft der Schlüssel. Von entscheidender Bedeutung ist auch der musikalische Leiter des Jugendorchesters, dieser muss das Feuer entfachen. Und: Habt Geduld! Eine Kooperation wächst nicht von heute auf morgen, sondern entwickelt sich Schritt für Schritt. Aber es lohnt sich: für die Jugendlichen, für die Vereine und letztlich für die Zukunft unserer Blasmusik.”
Danke
Ein herzliches Dankeschön an Klaus Wachter für diesen sehr lebhaften und nützlichen Erfahrungsbericht über die Jugendblasorchester-Kooperation in Bad Waldsee und Umgebung!
Die Serie über Jugendkapellen-Kooperationen im Überblick
Praxisbeispiel: Eine gelungene Jugendkapellen-Kooperation – Ein Gastbeitrag von Klaus Wachter
Woran scheitern Jugendkapellen-Kooperationen? – Eine umfassende Analyse, eine Handlungsempfehlung und ein Muster-Kooperationsvertrag
Fahrplan: In 15 Schritten zur erfolgreichen Jugendkapellen-Kooperation
Bisher erschienene Beiträge zum Thema Jugendkapellen-Kooperationen
Über die Herausforderungen von Jugendkapellen-Kooperationen
Vorteile von Jugendkapellen-Kooperationen
Beispiele gelungener Jugendkapellen-Kooperationen