Programmauswahl: Musikalische Entwicklung oder Publikumswirksamkeit?
Round-Up zum Thema Programmauswahl – künstlerische Vision oder pragmatischer Kompromiss?
Die Programmauswahl ist ein Drahtseilakt zwischen musikalischem Anspruch, Spielbarkeit für das Orchester und Publikumserwartung. Viele Dirigent:innen kämpfen hier mit sich – und manchmal auch mit Vereinsvorständen und den Musiker:innen. In diesem Round-Up beantworten die sechs Dirigenten Gauthier Dupertuis, Timo Kächele, Jürgen Kunkel, Bernhard Schlögl, David Schöpf und Stephan Wehrle jeweils vier Fragen zum Thema Programmauswahl – künstlerische Vision oder pragmatischer Kompromiss.
In diesem ersten Beitrag beantworten die sechs Dirigenten ganz konkret folgende Frage:
Was ist für Dich wichtiger: die musikalische Entwicklung des Orchesters oder Publikumswirksamkeit?
Gauthier Dupertuis

Gauthier Dupertuis dirigiert die Brass Band La Lyre de Conthey (1. Klasse), das Harmonieorchester Echo du Trient de Vernayaz (2. Klasse) und das O.V.N.I. – Orchestre à Vent Non Identifé (Höchstklasse).
Aus rein künstlerischer Sicht stellt sich diese Frage gar nicht: Die musikalische Entwicklung des Orchesters muss im Vordergrund stehen. In unseren Orchestern, die überwiegend aus Amateurmusiker:innen bestehen, sind es die Musiker:innen, die wochenlang die Werke einstudieren – und nicht das Publikum! Natürlich muss man hier differenzieren und bestimmte externe Komponenten hinzufügen, insbesondere die Notwendigkeit, Konzertbesucher zu gewinnen, um die Musiksaison zu finanzieren. Das Wichtigste ist jedoch, auf die Aufgeschlossenheit unseres Publikums zu vertrauen, wenn die Dinge gut durchdacht und präsentiert werden. Wenn die Musikerinnen und Musiker des Orchesters überzeugt sind, sollte es ihnen nicht schwerfallen, ihr Publikum zu überzeugen. Sehr oft sind wir überrascht, wie sehr auch dem Laienpublikum scheinbar schwer zugängliche Stücke gefallen. Oft sind es nicht die leicht zugänglichen Stücke, die die Zuhörerinnen und Zuhörer am meisten beeindrucken.
Timo Kächele

Timo Kächele dirigiert die Stadtkapelle Sindelfingen und ist Posaunist beim Landespolizeiorchester Baden-Württemberg
Das ist eine sehr gute Frage, denn diese Diskussion kenne ich seit vielen Jahren vom Jugendorchester, über Auswahlorchester und vor allem auch im professionellen Bereich. Sie gipfelt meistens im Spannungsfeld, ob wir dem Publikum „nach dem Mund“ spielen müssen, oder es in den Hörgewohnheiten „erzogen“ werden muss. Das „Erziehen“ bezieht sich dann immer auf besonders schwer zu spielende und anstrengend zu hörende Stücke. Ich bin jemand, der sowas gerne hat und vielleicht sogar erwartet. Mich strengt es mehr an, ein populäres Stück schlecht gespielt anhören zu müssen. Meiner Meinung nach kann das Publikum gerne herausgefordert werden, vor allem, wenn eine gute Moderation das Verständnis für das jeweilige Werk fördert und vielleicht sogar Neugierde weckt.
Als Dirigent musst du dein Orchester so gut kennen und einschätzen können, dass du deine Musikerinnen und Musiker förderst und sie immer am Anfang eines Projektes vermeintlich ein wenig überforderst. Dann kann man sich entwickeln. Das kann sowohl bei leicht, als auch bei schwer zu hörenden Stücken der Fall sein. Die Programmauswahl ist daher wirklich eine superwichtige Kernaufgabe des Dirigenten, der dann nicht nur Ego-Trips fahren kann, sondern das Können seines Orchesters, die Erwartung seines Publikums und eine Weiterentwicklung unter einen Hut bringen muss.
Jürgen Kunkel

Jürgen Kunkel ist Dirigent der Blaskapelle Ebenhausen
Ich finde beides muss ein gesundes Mischungsverhältnis haben. Mein Orchester macht einen Spagat zwischen Blasmusik-Auftritten im Sommer und konzertante Musik im Frühling mit dem verbundenen Jahreskonzert. Es muss den Musikern Spaß machen. So spielen sie auch “Schulungsstücke” lieber und der Funke zum Publikum springt dann auch über.
Bernhard Schlögl

Bernhard Schlögl ist Dirigent des Sinfonischen Blasorchesters Tirol und ist künstlerischer Leiter der Innsbrucker Promenadenkonzerte
Zwischen Erwartung und Haltung – Gedanken zur Konzertprogrammgestaltung
Ein viel diskutiertes und oft auch emotional behaftetes Thema: Musik wird auf der einen Seite sehr subjektiv wahrgenommen, gleichzeitig lassen sich in unserer Gesellschaft klare Muster von Erwartungshaltungen und musikalischer Sozialisierung erkennen. Viele Menschen verbringen täglich mehrere Stunden mit diversen Radiosendungen, in denen ein Pop-, Rock- oder Schlagerhit dem nächsten folgt – immer fröhlich, immer eingängig, nach wenigen Minuten wieder vorbei.
Es liegt also nahe, dass Menschen, die Musik vor allem als Begleiter durch den Alltag konsumieren, mit ähnlichen Erwartungen auch in unsere Konzerte gehen. Und das ist ja zunächst einmal ein guter erster Schritt.
Vorab möchte ich festhalten: Diskussionen darüber, was gespielt werden darf oder soll, ob Musikstücke immer einer einheitlichen Form folgen müssen oder ob ein individueller, mutiger Weg erlaubt ist, ja sogar die Frage nach „guter“ oder „schlechter“ Musik – all das ist so alt wie das Musizieren selbst, besonders vor einem heterogenen Publikum.
Ein Blick zurück: Konzertprogramme im 19. Jahrhundert
Einen meiner Texte zum Thema Freiluft- bzw. Promenadenkonzerte möchte ich hier kurz anführen. Anhand eines Beispiels aus dem 19. Jahrhundert wird deutlich, dass Konzertprogramme nie, oder zumindest nur selten, allen gleichermaßen gefallen können. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob wir uns diesem Anspruch überhaupt stellen müssen:
(…) Erwähnenswert ist Louis Jullien (1812–1860), der aufgrund einer Insolvenz von Paris nach London floh und dort eine Karriere als Dirigent bei Promenadenkonzerten begann. In den folgenden Jahren veränderte er die Konzertprogramme maßgeblich und wurde besonders durch seine Beethoven-Abende bekannt.
Jullien benannte seine Konzerte jeweils nach einem Komponisten, dessen Werke den gesamten ersten Konzertteil bestimmten – Mendelssohn-Abend, Weber-Abend, Mozart-Abend, Beethoven-Abend usw. Seine Promenadenkonzerte im Covent Garden Theatre boten ab 1844 zwei deutlich unterschiedliche Programmhälften:
In der ersten Hälfte erklang konzertante, ernstere Musik, in der zweiten populäre Tanzmusik. Besucherinnen und Besucher konnten selbst entscheiden, welche Konzerthälfte sie hören wollten, und durften nicht nur in der Pause, sondern auch während der Spielzeit kommen und gehen. (…)
Offensichtlich gab es eine Zeit, in der sich die Menschen selbst aussuchten, was sie hören wollten und nicht umgekehrt, dass ein Orchester möglichst bemüht war, es allen recht zu machen.
Zwischen Höflichkeit und Unvermeidlichkeit
Ehrlich gesagt käme es mir heute allerdings merkwürdig vor, wenn Besucherinnen und Besucher während eines meiner Konzerte den Saal verlassen oder nach und nach eintreffen würden. Höflichkeit und Respekt binden unser Publikum über die gesamte Konzertdauer heute an den Stuhl.
Das bringt naturgemäß mit sich, dass einzelne Werke bei manchen durchfallen, während andere begeistern – und umgekehrt. Genau darin liegt aber auch ein wesentlicher Teil des Konzertbesuchs.
Entwicklung oder Publikumswirksamkeit?
Damit komme ich auf die Frage zurück: Was ist für dich wichtiger – die musikalische Entwicklung des Orchesters oder die Publikumswirksamkeit?
Ich antworte darauf ganz selbstbewusst: Ich plane meine Programme absolut egoistisch. Ich spiele, was mir gefällt, was mich inspiriert und was für mich persönlich gute Musik ist. Dabei mache ich kaum einen Unterschied zwischen Transkriptionen und Originalwerken – technisch umsetzbar muss es sein, das ist das einzige Kriterium.
Was die Entwicklung eines Orchesters betrifft, bin ich überzeugt: Jede Art von Musik, der wir uns ernsthaft nähern und an der wir intensiv arbeiten, bringt sowohl das Orchester als auch die Zuhörerinnen und Zuhörer weiter. Musizieren folgt letztlich immer denselben physikalischen und musikalischen Gesetzen – Zeit, Sprache (von Artikulation bis Phrasierung), Intonation und vieles mehr.
Natürlich gibt es auch Momente, in denen ich mir denke: Eigentlich nicht ganz mein Fall, aber vermutlich sehr wirkungsvoll fürs Publikum. Hier darf (soll) sich ein Dirigent ruhig trauen, die eigenen Gewohnheiten zu verlassen und Neues auszuprobieren. Dieses Thema würde allerdings einen eigenen Blogbeitrag verdienen.
David Schöpf

David Schöpf dirigiert die Stadtkapelle Illertissen, die Musikkapelle Opfenbach, den Musikverein Lamerdingen, den Musikverein Mattsies sowie die Bezirksjugendblasorchester ASM Bezirk 5 Kaufbeuren und ASM Bezirk 7 Lindau. Außerdem die Schwäbische Jugend Brass Band.
Bei mir steht immer die musikalische Entwicklung des Orchesters im Vordergrund. Dabei bekommt jeder Verein ein eigenes Programm, welches darauf ausgelegt ist, die derzeitigen „Schwachstellen“ in die richtige Bahn zu lenken und zu verbessern, denn: man kann am meisten verbessern und herausholen am „schwächsten Glied der Kette“. Dabei kann es eine generelle musikalische Baustelle sein, an der man arbeiten möchte wie z.B. Phrasierung, Taktwechsel oder Klangausgleich oder auch ein bestimmtes Register, welches man fördern und fordern möchte. Die dementsprechende Literatur dann zu finden, erfordert viel Zeit und Mühe, aber lohnt sich immer. Meine Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt: Wenn die Qualität des Orchesters steigt, steigt auch die Zuhörerzahl. Aber egal, wie viele Zuhörer da sind, das ein oder andere bekannte und „nur“ publikumswirksame Stück darf, dann schon im Programm vorkommen. Aber ich würde behaupten, dass die Stückauswahl nur einen kleinen Teil zur Publikumswirksamkeit beiträgt. Viel wichtiger ist für mich, wie das Orchester auftritt, wie es auf der Bühne wirkt und ob die MusikerInnen Spaß haben zu spielen. Wenn die Bühne lebt und zusammen Musik gemacht wird, ist es meist viel spannender und wirksamer für das Publikum, selbst wenn die Musik auf die Entwicklung des Orchesters ausgelegt worden ist.
Stephan Wehrle

Stephan Wehrle dirigiert den Musikverein Siegelau
Ein ausgewogenes Konzertprogramm kann aus meiner Sicht beides ganz wunderbar erfüllen. Natürlich ist es mein Ziel, dass sich Werke darin befinden, die den Horizont erweitern und bei denen das Orchester die Komfortzone verlassen muss. Aber das sollte auch ausgeglichen werden mit Werken, die vergleichsweise leicht von der Hand gehen, bereits in den Proben Spaß machen und bekannte Stärken voll ausreizen. Natürlich kann nicht gleich viel Zeit in der Vorbereitung investiert werden, aber die beliebten Werke eignen sich dann z. B. auch wunderbar, die Proben mit ihnen ausklingen zu lassen, nachdem man länger an den schwierigen Werken gearbeitet hat.
Umgekehrt sollte ich als Konzertbesucher nicht voraussetzen, dass mich jedes Werk gleichermaßen anspricht. Wenn ich mit der Ouvertüre oder dem Hauptwerk nichts anfangen kann, gibt es schließlich noch weitere Stücke oder vertretene Musikrichtungen, die mir womöglich gut bis sehr gut gefallen.
Wenn ich mich also entscheiden muss, steht zwar die musikalische Entwicklung im Vordergrund, aber ich versuche hier stets den Kompromiss zu finden.
Übersicht über die Round-Up-Serie:
Teil 1: Programmauswahl: Musikalische Entwicklung oder Publikumswirksamkeit?
Teil 2: Programmauswahl: Welche Werke kommen (nicht) an?
Teil 3: Programmauswahl: Was tun bei Widerstand von den Musiker:innen?
Teil 4: Programmauswahl: Mutige Konzertprogramme

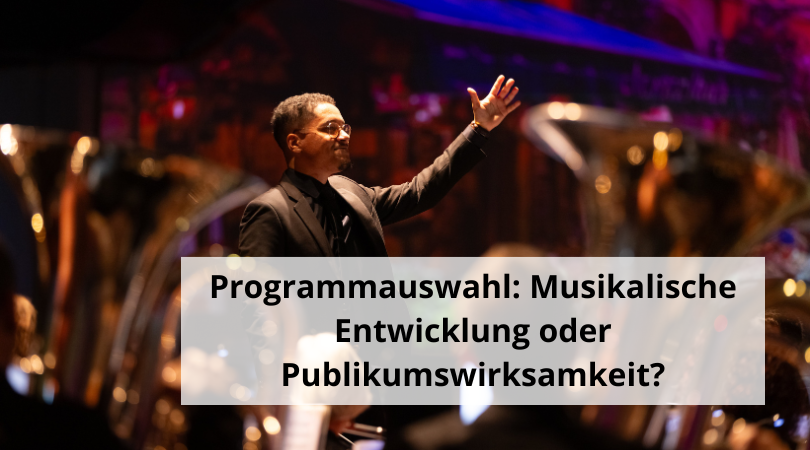



Aus meiner Sicht wird manchmal die Vermittlung der Musik und Inhalte etwas vernachlässigt, denn hier gibt es tolle Methoden, vielleicht etwas ungewohnte Literatur sowohl zuerst den Musiker:innen als auch dem Publikum im Konzert zugänglich zu machen.
Ein Schlüsselelement im Konzert ist denke ich die Moderation. Es interessiert wahrscheinlich die wenigsten Menschen im Publikum, wann der:die Komponist:in an welcher Hochschule bei wem studiert hat. Aber um was geht es im Stück? Warum wurde es geschrieben? Was gibt es zu entdecken/erhören? Gibt es Bilder, die wir mitgeben können? Wir sollten unserem Publikum Zugänge zur Musik schaffen und Bezüge zum Alltag herstellen, damit sie die Musik ebenso berühren kann wie sie das (hoffentlich) bei uns tut.