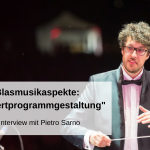Blasmusikaspekte: Musikkommission im Musikverein
Ein Interview mit Marco Zingg
In der Reihe “Blasmusikaspekte” werden im Interview mit jeweils einer Persönlichkeit ein Teilbereich bzw. ein besonderer Aspekt der Blasmusik bzw. unseres Musikvereinswesen diskutiert. Es kommen jeweils Spezialist:innen zu Wort, die sich näher bzw. tiefer mit einem Teilbereich der Blasmusik beschäftigt haben bzw. besondere Fachleute für die jeweiligen Themen sind.
Herzlichen Dank an Marco Zingg, der in diesem Beitrag meine vielen Fragen zum Thema Musikkommission im Musikverein beantwortet hat.
Was ist Deinem Verständnis nach eine Musikkommission?
Eine Musikkommission unterstützt den Dirigenten / die Dirigentin bei der Literaturauswahl und kümmert sich um alle musikalischen Angelegenheiten in einem Blasmusikverein.
Welche Aufgaben übernimmt eine Musikkommission? Welche Aufgaben hat der MuKo-Präsident, welche die MuKo-Mitglieder?
Themen wie Besetzung, Literaturauswahl und die Aufbereitung der Noten, gehören in die MuKo. Der MuKo-Präsident / die MuKo-Präsidentin hat wie der Vereinspräsident / die Vereinspräsindentin die Verantwortung in seinem Gremium, delegiert die Aufgaben und organisiert die Sitzungen. Anstehende Gespräche mit Mitgliedern (musikalisches) übernimmt meistens der MuKo-Präsident / die MuKo-Präsidentin.
Welche Rolle spielen in der Konzertprogramm-Auswahl sowohl Dirigent:in als auch Musikkommissions-Mitglieder?
Die Handhabung variiert von Verein zu Verein. Oft hat der Dirigent oder die Dirigentin bereits eine thematische Idee oder konkrete Literaturwünsche, die unbedingt ins Konzertprogramm aufgenommen werden sollen. Unabhängig davon haben alle Mitglieder der MuKo die Möglichkeit, Vorschläge zu Themen, Solisten und Musikstücken einzubringen.
Welche Rolle spielen in der Auswahl des Sommerprogramms sowohl Dirigent:in als auch Musikkommissions-Mitglieder?
Ich gehe davon aus, dass hier die Unterhaltungsmusikliteratur gemeint ist, die häufig im Marschbuch verwendet wird und bei kleineren Auftritten im eigenen Dorf zum Einsatz kommt. In unserem Verein besteht das Marschbuch meist aus etwa 20 Stücken, die nicht jedes Jahr komplett ausgetauscht werden. Gelegentlich werden einzelne Titel aussortiert oder durch neue ergänzt. Die Auswahl konzentriert sich dabei überwiegend auf leichte Unterhaltungsmusik, Märsche und Polkas.
Welche Personen innerhalb des Musikvereins sind für eine Musikkommission geeignet? Was sind die Voraussetzungen? Welche Eigenschaften müssen MuKo-Mitglieder mitbringen?
Grundsätzlich kann jedes Vereinsmitglied in der Musikkommission mitwirken, vorausgesetzt, es bringt die nötige Motivation mit. Es ist dabei nicht erforderlich, dass alle Mitglieder literaturbewandert sind. Vielmehr ist es von Vorteil, wenn die MuKo aus Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Register besteht. Diese können beurteilen, wie die Besetzungsstärke ihres Registers ist und ob bestimmte Stücke die einzelnen Stimmen zu stark fordern.
Neben der Literaturauswahl ist auch die Rolle eines Notenverwalters von Vorteil. Dieser kümmert sich um die Archivierung der Stücke und stellt sicher, dass diese für alle Mitglieder zugänglich sind. Es braucht also weit mehr als nur „Experten:Innen“ in der Literaturauswahl, um eine funktionierende Musikkommission zu gestalten.
„Der Dirigent / die Dirigentin gibt die musikalische Ausrichtung vor.“ – Wie stehst Du persönlich zu dieser Aussage?
Die Meinung und Vorstellung des Dirigenten oder der Dirigentin sind zweifellos wichtig. Allerdings müssen die Ideen zur musikalischen Ausrichtung nicht immer ausschliesslich von ihnen kommen. Oft haben auch Mitglieder kreative Vorschläge und Projektideen.
Es ist jedoch verständlich und vollkommen normal, dass ein Dirigent in einem 3. Klasse Verein einen stärkeren Einfluss ausübt als in einem 1. Klasse Verein. Dies liegt unter anderem daran, dass in höher klassierten Vereinen oft auch Mitglieder aktiv sind, die selbst dirigieren oder generell enger mit der Materie vertraut sind.
Wie kommen Dirigent:in und MuKo zu einer optimalen Auswahl eines Konzertprogramms? Wie sieht der optimale Weg aus?
Jeder Verein hat seine eigene Methode, Konzerte zu planen. Ich kann nur aus meiner Erfahrung schreiben und von den Ansätzen, die sich bei meinen Vereinen bewährt haben. In den beiden Vereinen, bei denen ich aktiv bin und auch in der Musikkommission mitwirke, organisieren wir jeweils ein Jahreskonzert im Frühling sowie ein Kirchen- oder Adventskonzert im Herbst oder Dezember.
Der erste Schritt ist immer die Festlegung des Konzertkonzepts. Soll das Konzert ein spezifisches Thema haben, wie zum Beispiel „Jazz Night“, oder bleibt es thematisch offen? Möchte man einen geschichtlichen Hintergrund beleuchten oder zum Beispiel die Jugend in den Mittelpunkt stellen?
Sobald das Thema oder der Leitgedanke steht, folgt die Auswahl der Musikstücke. Hierbei wird aus meiner Sicht oft ein Fehler gemacht: Stückvorschläge werden wahllos und ohne klare Struktur eingereicht. Deshalb empfehle ich, ein „Programm-Manuskript“ zu erstellen. Dieses könnte wie folgt aussehen:
- Eröffnungsstück
- Solo
- Originalwerk/Konzertstück
- Hymne
- Marsch
———PAUSE———
- Eröffnungswerk 2. Konzertteil
- Filmmusik
- Originale Unterhaltungsmusik
- Showstück mit Solo
- Unterhaltungsstück
- Konzertfinale
—————-ENDE——
- Zugabe
- Zugabe
Ein „Programm-Manuskript“ unterscheidet sich natürlich von Verein zu Verein, je nach Ausrichtung und den bevorzugten Schwerpunkten oder Musikgenres. Deshalb ist es empfehlenswert, im Vorfeld klar zu definieren, welche Genres das Konzert abdecken soll, noch ohne konkrete Titel zu nennen.
Mit diesem groben Konzept lassen sich gezielt Vorschläge für jedes Genre sammeln, anstatt sich nur auf 1–2 bevorzugte Genre zu beschränken. Das Ergebnis ist ein abwechslungsreiches Konzertprogramm, das nicht nur die Vielfalt der Musik unterstreicht, sondern auch die MuKo-Sitzungen effizienter macht.
Berücksichtigt dabei stets die Gesamtspieldauer des Konzerts, inklusive der Stücklängen, Ansagen und eventuell eingeplanter Pausen.
Was sind Deine persönlichen Erfahrungen als Musikkommissions-Mitglied und -Präsident innerhalb eines Musikvereins?
Für mich gibt es einen wichtigen Grundsatz: In einem Musikverein – unabhängig von der Stärkeklasse – geht es nicht nur darum, Musik zu machen. Ein Verein braucht einen engagierten Vorstand, eine funktionierende Musikkommission und jedes einzelne Mitglied, das bereit ist, seinen Beitrag zu leisten.
Dabei sollte jedem klar sein, dass die meisten Vereine nicht professionell aufgestellt sind. Es bedarf einer grossen Menge ehrenamtlicher Arbeit, damit ein Verein auch abseits der Musik erfolgreich sein kann. Die Erfahrung zeigt: Erfolgreiches Musizieren ist oft nur möglich, wenn auch die organisatorischen Abläufe reibungslos funktionieren.
Daher ist es entscheidend, dass alle Mitglieder bereit sind, den Verein auch organisatorisch zu unterstützen. Jeder kann ein Amt übernehmen oder auf andere Weise mithelfen. Jede Aufgabe zählt!
Wie funktioniert die Arbeit einer MuKo innerhalb eines Musikvereins Deiner Meinung nach am besten? Hast Du ganz praktische Tipps?
Das A und O für erfolgreiches Arbeiten in der MuKo ist eine frühzeitige Planung und regelmässige Kommunikation. Wenn ausreichend Vorbereitungszeit für Sitzungen zur Verfügung steht, können sich alle Beteiligten besser mit der Literaturauswahl auseinandersetzen. Dies fördert sowohl die Qualität als auch die Effizienz erheblich.
Was ist für Dich persönlich ein absolutes No-Go in der Programm-Auswahl?
Das Wort persönlich ist hier entscheidend! Oft spürt man bei Konzerten deutlich, wie viel Zeit und Gedanken in die Programmgestaltung geflossen sind. Der einfachste Weg wäre, das Programm mit bewährten „alten“ Klassikern zu füllen, die beim Publikum immer gut ankommen. Das ist keineswegs falsch – ein Klassiker im Programm hat absolut seine Berechtigung. Entscheidend ist jedoch, wie die Stücke präsentiert werden und nicht nur, welche Stücke im Programm enthalten sind.
Wenn ein Konzertprogramm mit Spielfreude und Leidenschaft dargeboten wird, springt der Funke schnell aufs Publikum über – unabhängig davon, ob eine Polka, ein Konzertstück oder ein Popsong gespielt wird. Als Konzertbesucher lasse ich mich gerne auch für neue Stücke begeistern. Originale Blasmusikliteratur ist daher genauso gut geeignet. Daher ermutige ich dazu, Neues zu wagen und auszuprobieren. Traditionen sind wertvoll und haben ihren Platz, doch auch Traditionen hatten irgendwann einmal einen Anfang.
Ein häufig gehörtes Argument ist, dass mehr Popmusik nötig sei, um junge Musikanten und Musikantinnen zu gewinnen. Dem stimme ich nicht ganz zu. Die Blasmusik verfügt über eine grosse Menge an grossartigen Originalwerken, die weit über Konzert- oder Wettbewerbsstücke hinausgehen. Es gibt zahlreiche originale Unterhaltungswerke sowie Arrangements aus den Bereichen Klassik, Volksmusik, Tradition und vielen weiteren Genres, die hervorragend geeignet sind. Junge Menschen lassen sich auch mit solcher Musik gewinnen – hier kommt es wieder darauf an, wie diese präsentiert wird.
Als ich als kleiner Junge die Konzerte meines Dorfvereins besuchte – dem Verein, in dem ich nun seit über 16 Jahren spiele – war es nicht die Popmusik, die mich beeindruckte. Es waren die einzigartigen Klänge, die ein Blasmusikverein erzeugen kann. Solche Klänge kommen besonders bei originaler Literatur oder klassischen und traditionellen Arrangements zur Geltung. Das war der Grund, warum ich mich für ein Blasinstrument entschied.
Ein weiteres No-Go bei der Programmgestaltung sind für mich ungeplante Zugaben. Diese werden oft kurzfristig aus der Unterhaltungsmappe gezogen und sind qualitativ meist schwächer als das restliche, gut einstudierte Programm. Zugaben sollten stets geplant und vorbereitet werden, um den Konzertabend gelungen abzurunden.
Auch die Konzertdauer ist ein wichtiger Faktor. Ein Konzert, das inklusive Pause 2,5 Stunden dauert, ist für mich oft an der Grenze. Das fällt einem besonders auf, wenn man selbst ein solches Konzert besucht. Lieber höre ich, dass das Publikum das Konzert als kurzweilig empfand oder gerne noch ein Stück gehört hätte, als dass es zu lange gedauert hat.

Welche Aufgaben hat die Musikkommission innerhalb eines Blasmusikverbandes und welche Aufgaben hat im speziellen der MuKo-Präsident?
Das ist eine schwierige Frage, die ich nicht abschliessend beurteilen kann. Klar ist, dass die Aufgaben in einem Verband ganz anders sind als in einem Verein. Aus meiner Sicht sollte die Musikkommission die musikalische Situation der Vereine analysieren und herausfinden, wo die Probleme liegen. Sind diese erst einmal erkannt, sollten in Zusammenarbeit mit dem gesamten Blasmusikverband Lösungsansätze erarbeitet werden, um die Vereine gezielt zu unterstützen.
Ein immer aktuelles Thema ist dabei die Jugendförderung. Ein Blasmusikverband hat oft Zugang zu finanziellen Mitteln, etwa durch Behörden oder Gemeinden, die für einzelne Vereine möglicherweise schwer erreichbar sind.
Ein weiteres wichtiges Anliegen ist die Förderung geeigneter Literatur für die 3. und 4. Stärkeklasse sowie für Vereine mit kleineren Besetzungen. Gerade für Musikfeste ist es für diese Vereine oft eine Herausforderung, passende Werke zu finden. Dies sollte nicht nur als Aufgabe der Musikverlage betrachtet werden, sondern auch als wichtiger Auftrag für die Musikverbände.
Was kann in den MuKos der Musikvereine schief laufen? Welches sind die häufigsten Kritik-Punkte an der MuKo innerhalb eines Musikvereins?
Bleibt stets selbstkritisch, auch wenn das nicht immer einfach ist. Holt regelmässig Feedback vom Verein ein: Was kann verbessert werden? Die Kommunikation spielt dabei eine zentrale Rolle. Änderungen im Verein sollten immer zeitnah und regelmässig kommuniziert werden. Informiert den Verein darüber, dass Vorschläge oder Anregungen jederzeit an die Musikkommission oder auch den Vorstand weitergegeben werden können. Nur so lässt es sich effizient und im Sinne der Vereinsphilosophie arbeiten.
Welches sind die größten Herausforderungen der Musikkommissions-Mitglieder innerhalb eines Musikvereins?
Ich denke dabei an personelle Angelegenheiten. Wie teilt man einem Mitglied respektvoll mit, dass es problematisch ist, wenn es 50 % der Proben nicht besucht? Wie erklärt man einem langjährigen Mitglied auf der ersten Stimme, dass man einer jüngeren Person die Chance geben möchte? Solche Themen sind unangenehm, aber dennoch von grosser Bedeutung.
Es ist entscheidend, alle Mitglieder gleich zu behandeln und auch unangenehme Gespräche zu führen. Wenn das Verhalten eines Mitglieds über längere Zeit hinweg nicht den Erwartungen entspricht, muss dies angesprochen werden. Nur so kann das Klima im Verein gesund und ausgeglichen erhalten bleiben.
Was, wenn der Dirigent / die Dirigentin absolut gegen eine Musikkommission ist?
Wichtig ist, dass ein Dirigent oder eine Dirigentin in der Regel bei einem Verein angestellt ist. Der Verein legt die „Arbeitsgrundlagen“ fest. Daher sind Gespräche und eine klare Kommunikation bereits im Anstellungsverfahren entscheidend, um Erwartungen und Rahmenbedingungen von Anfang an klar zu definieren.
Welche Argumente einmal in Richtung Dirigent:in und einmal in Richtung Musiker:innen sprechen für eine Musikkommission? Was können Gründe gegen die Einführung einer Musikkommission innerhalb eines Musikvereins sein?
Für mich gibt es keinen Grund gegen eine Musikkommission. Die Verantwortung wird auf mehrere Schultern verteilt, sodass sie nicht von einer einzelnen Person abhängt. Aufgaben können gemeinsam aufgeteilt werden, und jede Person bringt Ideen oder Erfahrungen ein, die auch für den Dirigenten oder die Dirigentin von Wert sein können.
Welche Vorgehensweise zur Einführung einer Musikkommission in einem Musikverein empfiehlst Du?
Es sollte keine spontane Entscheidung sein, plant deshalb sorgfältig. Setzt euch ein Konzert als Ziel und idealerweise ein Jahr im Voraus. So habt ihr genügend Zeit, ein Gremium zusammenzustellen und die Sitzungen zu planen. Definiert in der Vereinsleitung klar, welche Kompetenzen die Musikkommission (MuKo) hat und welche Aufgaben sie übernimmt. Zu Beginn könnt ihr euch eventuell nur auf die Auswahl der Konzertliteratur konzentrieren.
Dirigenten-Auswahl: Wie findet ein Musikverein den Dirigenten / die Dirigentin, die zu ihm passt?
Das ist eine sehr gute, aber auch schwierige Frage. Wenn ich Inserate von Vereinen lese, fallen mir oft dieselben Punkte auf: Zum Beispiel: „Wir sind ein bunt gemischter Haufen mit 47 MusikantInnen und spielen in der 3. Stärkeklasse“, ergänzt durch Informationen zu den jährlichen Events. Oftmals fehlen jedoch weitere, tiefere Informationen. Ein Dirigent interessiert sich jedoch viel mehr dafür, was den Verein ausmacht und – fast noch wichtiger – ob der Verein bereit ist, neue Wege zu gehen.
Bei der Dirigentenwahl sollte ein Verein immer offen für Veränderungen sein. Dies gibt dem Dirigenten / der Dirigentin die Chance, seine / ihre Arbeitsweise einzubringen. Nach einem halben oder ganzen Jahr sollte ein Gespräch folgen, um zu überprüfen, welche Aspekte gut liefen und wo es Verbesserungspotential gibt. So entsteht eine wertvolle Chance für beide Seiten.
Wie ist die optimale Vorgehensweise bei der Auswahl eines Dirigenten/einer Dirigentin? Beschreibe die einzelnen Schritte.
Ich selbst habe wenig persönliche Erfahrung mit diesem Prozess, würde ihn aber in etwa so angehen:
- Stellt ein Gremium speziell für die Dirigentenwahl zusammen.
- Vorgehensweise und Zeitplan definieren
- Stelleninserat erstellen.
Macht im Inserat auf euch aufmerksam, beschreibt eure Besonderheiten und Ziele. Was macht euch aus? Welche Vision habt ihr? Was erwartet ihr vom neuen Dirigenten oder der neuen Dirigentin? Achtet auf die Gestaltung des Inserats. Es sollte erfrischend wirken. Gebt euch genauso viel Mühe wie bei euren eigenen Bewerbungsunterlagen, um möglichst viele Dirigenten/Dirigentinnen anzusprechen. - Verbreitet das Inserat auf so vielen Kanälen wie möglich: Blasmusikzeitschriften, Social Media, Musikschulen, Musikhochschulen und Musikverlage oder Musikgeschäfte, die direkten Kontakt zu Dirigenten / Dirigentinnen haben.
- Wenn ihr hoffentlich einige Bewerbungen erhalten habt, beginnt mit der Selektion.
- Berücksichtigt, wenn möglich, auch gegensätzliche Bewerbungen, um ein breites Spektrum an Kandidaten/Innen zu prüfen.
- Wenn ihr die Kandidaten/Innen nicht direkt zum Vordirigieren einladen möchtet, könnt ihr sie zu einem „Bewerbungsgespräch“ einladen. Manchmal wird anstelle des Vordirigierens auch bevorzugt, dass die finalen Dirigenten/Innen jeweils ein Projekt dirigieren.
Wenn Du für einen Tag „das Sagen“ innerhalb der Schweizer Blasmusikszene haben würdest, was würdest Du ändern?
Ein Tag würde wahrscheinlich nicht ausreichen, um Veränderungen umzusetzen, falls man überhaupt etwas ändern möchte. Für mich wäre es jedoch wichtig, dass die Jugendförderung aktiver angegangen wird, indem Kantonalverbände und weitere Unterverbände stärker eingebunden werden. In vielen Unterverbänden gibt es bereits sehr erfolgreiche Jugendförderprojekte, die meiner Ansicht nach mehr unterstützt werden sollten.
Die abschliessende Antwort auf diese Frage lautet jedoch: Ich möchte niemals „alleine“ die Verantwortung für eine so grosse Szene übernehmen. Dafür fehlt mir der nötige Weitblick. Es ist einfach, zu nörgeln und Fehler zu suchen. Solche Ämter zu übernehmen, ist jedoch eine ganz andere Herausforderung. Ein wenig mehr „Miteinander“ statt „Jeder für sich“ würde sicherlich nichts schaden.
Als erfahrenes MuKo-Mitglied und Mitarbeiter eines Musikverlags hast Du einen großen Einblick in die Verlagsszene und bestimmt auch ein großes Repertoire-Wissen: Was wünschst Du Dir persönlich von den a) Dirigent:Innen, b) von den Komponist:innen und c) von den Musikverlagen in puncto Neuem Repertoire? Was sind persönlich Deine größten Wünsche bezüglich Blasorchesterrepertoire?
Mein grösster Wunsch ist musikalische Vielfalt in allen Kategorien.
Den schwächer klassierten Vereinen wünsche ich vor allem Mut und Selbstvertrauen. Ihr seid keineswegs „schlecht“ oder „unattraktiv“. Im Gegenteil: Ihr spielt eine entscheidende Rolle in der Blasmusikszene! Es ist auch keine Schande, an einem Wettbewerb in einer niedrigeren Kategorie anzutreten als in den Vorjahren. Veränderungen im Vereinswesen sind normal, und es erfordert Mut, diese anzunehmen und darin neue Chancen zu erkennen. Manchmal ist ein Schritt zurück nötig, um sich langfristig weiterentwickeln zu können.
Jungen Komponisten / Komponistinnen empfehle ich, sich zunächst an „einfacheren“ Kompositionen zu versuchen, bevor sie sich an anspruchsvolle Werke wagen. Dies erfreut auch die Vereine in den entsprechenden Stärkeklassen.
Den Dirigentinnen und Dirigenten wünsche ich den Mut, Neues auszuprobieren, sei es bei der Stückauswahl oder in der Umsetzung innovativer Projekte.
Lasst die Blasmusikszene attraktiv und innovativ bleiben! Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, doch es braucht frische Impulse, um uns auch nach aussen ansprechend zu präsentieren.

Vita Marco Zingg
Marco Zingg (*1993) wuchs in Burgdorf – am Tor zum Emmental – in der Schweiz auf und lebt auch noch heute mit seiner Frau in der idyllischen Stadt. Nach zwei Jahren Blockflötenunterricht in der Grundschule begann er im Alter von 10 Jahren mit dem Euphonium. Seine Jugendmusikzeit verbrachte er in der Kadettenmusik Burgdorf und dem Jugendblasorchester Burgdorf.
Durch seinen Musiklehrer Ueli Kipfer – bei dem er rund 14 Jahre Unterricht geniessen durfte – begann sein Abenteuer Brass Band, indem Marco im Jahr 2008 zur Musik Frohsinn Oberburg stiess. Nebst der musikalischen Förderung lernte er auch schnell, wie wichtig es ist, sich im Verein einzubringen und gemeinsam bei Vereinsarbeiten anzupacken.
Im Jahr 2014 bekam er die Chance, sich als Solo-Euphonist bei der Brass Band Emmental zu behaupten. Mittlerweile kann er bereits auf mehr als 10 Jahre Brass Band Emmental zurückschauen. Während dieser Zeit konnte er weitere Erfahrung bei der Nationalen Jugend Brass Band der Schweiz sowie in der Schweizer Militärmusik sammeln. Dazu kamen erfolgreiche Resultate an Solistenwettbewerben, wie zum Beispiel der Sieg am Schweizerischen Solisten- und Ensemble Wettbewerb in der Kategorie Euphonium im Jahr 2015. Auch mit den beiden Brass Bands konnte Marco grosse Erfolge feiern. Zu den 4 Schweizermeistertiteln mit der Musik Frohsinn Oberburg und den 3 Schweizermeistertiteln mit der Brass Band Emmental, kamen auch noch je ein Spezialpreis für das beste Solo-Euphonium hinzu.
Nebst dem aktiven Musizieren engagiert er sich auch gerne in den Vereinsleitungen sowie der Jugendförderung. Marco ist Präsident sowie Musikkommissions-Mitglied der Brass Band Emmental, MuKo Mitglied der Musik Frohsinn Oberburg, Mitgründer und aktuelles Vorstandsmitglied des Jugend Brass Band Lagers Emmental und Mitinitiant und OK-Mitglied des EMC – Emmental March Contests. Zusätzlich spielt er noch bei der Blaskapellenformation «CHraftwerk Brass».
Als gelernter Zierpflanzengärtner wechselte Marco im Jahr 2016 die Branche und arbeitet seitdem vollzeitig beim Musikverlag Frank. Er sieht es – das schönste Hobby zu leben, auszuüben und als Beruf zu haben – nicht als selbstverständlich und wünscht sich auch in ein paar Jahren noch eine gesunde und standhafte Blasmusikszene.