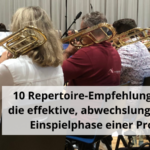Musikprobe im Blasorchester – MIT oder OHNE Pause?
Erfahrungswerte aus der Praxis & eine Empfehlung für Blasorchester-Dirigent:innen
Pausen oder nicht – das ist eine Frage, die in fast jedem Orchester irgendwann aufkommt. Und ehrlich gesagt: Ich habe dazu auch selbst schon meine Meinung geändert. Was in einem Ensemble gut funktioniert, kann im nächsten komplett kontraproduktiv sein. Genau deshalb wollte ich es wissen: Was denken Dirigent:innen und Musiker:innen wirklich über Pausen in der Musikprobe?
Die Kurz-Umfrage auf Facebook, die ich dazu gestartet habe, hat mich in ihrer Vielfalt, aber auch in ihrer Klarheit überrascht. Sie zeigt nicht nur Meinungen – sie liefert echte Erfahrungswerte aus dem Blasorchesteralltag. Und darauf kommt’s an.
Die Frage: Braucht eine zweistündige Musikprobe eine Pause?
Wenn du regelmäßig vor einem Blasorchester stehst, kennst du das: Die Frage nach dem optimalen Ablauf einer Probe ist mehr als reine Formsache. Besonders strittig – und oft emotional diskutiert – ist die Pause.
Hilft sie der Konzentration – oder bremst sie den Flow? Fördert sie das Miteinander – oder kostet sie nur wertvolle Zeit?
Ich habe die Frage gestellt – und viele fundierte, ehrliche und sehr praxisnahe Antworten erhalten. Das Ergebnis? Eine klare Tendenz mit feinen Nuancen.
PRO Pause – Die Argumente für eine Unterbrechung
Auch wenn die „Pause-Fraktion“ in der Minderheit ist, gibt es gewichtige Gründe, die für eine Unterbrechung sprechen:
Konzentration & geistige Erholung
Gerade bei Abendproben nach einem langen Arbeitstag empfinden einige Musiker:innen eine kurze Pause als willkommene geistige Erholung.
„Nach einer Stunde 5 Minuten Pause zerstört den Fokus nicht… Es gilt auch zu bedenken, dass die Proben meistens abends sind und alle schon einen langen Tag hinter sich haben.“ Benjamin M.
Raumklima & Sauerstoff
In manchen Proberäumen ist eine Lüftungspause schlicht notwendig – gesundheitlich wie musikalisch.
„Bei einem meiner MV’s müssen wir zwecks Sauerstoff zwischendurch lüften und somit pausieren.“ Renate B.
Kommunikation & Gemeinschaft
Die Probe ist nicht nur musikalisches Arbeiten, sondern auch ein Ort der Begegnung für die Musiker:innen. Einige Stimmen betonen, dass die Pause für soziale Gespräche wichtig ist und die Bindung der Musiker:innen untereinander stärkt.
„Die Pause ist für uns wichtig zur Kommunikation, denn nach Probenende fahren alle schnell nach Hause.“ Petra B.
„Ohne eine Pause geht die Kommunikation für ein funktionierendes Miteinander verloren.“ Sebastian S.
CONTRA Pause – Die Argumente gegen eine Unterbrechung
Die Mehrheit der Umfrageteilnehmer:innen spricht sich klar gegen eine klassische Pause aus. Die Argumente sind klar strukturiert und mehrfach genannt worden:
Fokusverlust & Proben-Effizienz
Viele Dirigent:innen beobachten, dass nach einer Pause der Fokus nicht zurückkommt, sondern verloren geht. Der Neustart dauert, das Energielevel sinkt.
„Nach der Pause ist die Konzentration absolut im Keller.“ Uwe H.
„Bis man nach 15 Minuten Pause alle wieder beieinander hat, sind locker 30 Minuten vorbei.“ Axel F.
Effektive Nutzung der Zeit
Die meisten Orchester proben am Abend – oft mit zeitlichen Einschränkungen. Wer effektiv sein will, will nicht unterbrechen, sondern den Flow nutzen.
„1:45 ohne Pause. Die Probenzeit ist effektiv genutzt und wer mag, bleibt nach der Probe noch zum Plaudern.“ Nicole M.
„Zwei Stunden durch mit voller Konzentration. Pünktlich anfangen und pünktlich aufhören, sowie ein gut vorbereiteter Dirigent ist das Geheimnis.“ Hermann S.
„Pseudopausen“ statt offizieller Unterbrechung
Viele Dirigent:innen verzichten bewusst auf eine offizielle Pause – bauen aber natürliche Erholungspausen im Ablauf ein. Dazu gehören Ansagen, das Proben mit einzelnen Registern oder längere Übergänge zwischen den Stücken.
„Die Ansagen unserer Vorsitzenden etwa in der Hälfte der Probe sind als Pause völlig ausreichend.“ Thomas U.
„Da immer mal wieder Spielpausen für einzelne Register sind, ist das gut machbar.“ Xenia K.
Tendenz & Zwischenfazit
Die Antworten aus der Umfrage lassen ein klares Bild erkennen:
- Etwa drei Viertel der Rückmeldungen sprechen sich gegen eine klassische Pause aus.
- Die Mehrheit der Dirigent:innen empfindet das Durchproben als effektiver, strukturierter und konzentrierter.
- Gleichzeitig wird Kommunikation und soziale Interaktion nicht grundsätzlich abgelehnt – sie wird nur bewusst außerhalb der Spielzeit verlagert.
Diejenigen, die mit Pause arbeiten, betonen oft, dass sie sie nicht nur aus Gewohnheit machen, sondern aus Raum- oder Ensemble-spezifischen Gründen.
Empfehlung für Dirigent:innen und Vereinsverantwortliche
1. Treffe eine bewusste Entscheidung – nicht aus Gewohnheit.
Reflektiere deine Probenstruktur: Was ist heute das Ziel? Wie ist die Belastbarkeit meines Ensembles?
2. Nutze „Pseudopausen“ strategisch.
Wenn du auf eine formale Pause verzichtest, plane bewusste Erholungsinseln ein – Registerwechsel, Ansagenblöcke, konzentrierte Atempausen – vielleicht mit Atemübungen?
3. Gestalte Raum für Gemeinschaft – außerhalb der Spielzeit.
Viele Ensembles berichten: Wer sich nach der Probe zum Gespräch trifft, erlebt bessere Kommunikation und eine produktivere Probe.
4. Sprich mit deinem Orchester.
Frage regelmäßig nach: Was empfinden die Musiker:innen als hilfreich? Was funktioniert – was nicht mehr?
Persönliche Note zum Nachdenken
Probenarbeit ist nicht nur arbeiten am musikalischen Kontext – sie ist Beziehungsarbeit, Struktur, Kommunikation und Motivation in einem. Wenn du als Dirigent:in weißt, warum du auf eine Pause verzichtest oder wann du eine einplanst, wirst du dein Orchester mitnehmen. Nicht jede Probe braucht eine Pause – aber jede Probe braucht einen Plan.
Und du? Wie hältst du es mit Pausen in deinem Orchester? Schreib mir oder kommentiere direkt unten im Kommentarfeld – ich freue mich über weiteren Austausch und neue Impulse aus der Praxis!
Beitragsbild: Gerald Oswald probt mit einem Teilnehmer:innen-Orchester beim Österreichischen Blasmusik Forum in Ossiach/Kärnten.